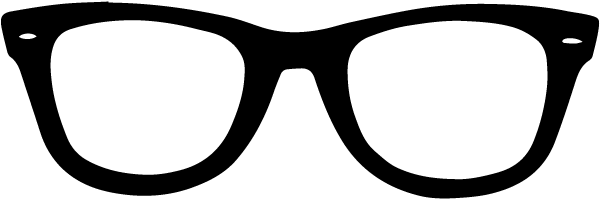Tante Elena
TANTE ELENA ERKLÄRT DIE WELT,
OB DIE WELT WILL ODER NICHT!
Siebzehn Situationen und deren bemerkenswerte Auflösungen durch eine außergewöhnliche Tante und ihre besondere Begabung, ihre Lebensweisheit aus Jahrzehnten in zeitgerecht alltagstaugliche Empfehlungen zu übersetzen. Zwischen zwei Zigaretten.
17 kurze Geschichten über Tante Elena:
01. Tante Elena
02. Von guten Witzen
03. Shabbat shalom
04. Kein Vergleich
05. Von Ethik
06. Die Sicht auf die Dinge
07. Ewigkeit vs. Unendlichkeit
08. Von Verrat
09. Von Chuzpe
10. Déjà Vu
11. Schnaps
12. Zeugnisausgabe
13. Sprechtag
14. Schein und Sein
15. Prince “live”
16. Die richtige Frage
17. Von Wundern
01. Tante Elena
In den neunzehnhundertachtziger Jahren hatte ich eine jüdische Mitschülerin. Bea war keine sehr enge Freundin und doch verbrachten wir gerne einige Zeit miteinander. Sehr gerne erinnere ich mich auch an ihre Tante. Oder Großtante, so genau weiß ich das nicht mehr. Sie war um einiges älter als die Eltern, jedoch auch erheblich jünger als die noch lebende Großmutter.
Sie hatte schieferfarbene Locken mit weißen Strähnen, ständig dicke Ränder um die tiefschwarzen Augen und rauchte filterlos Kette zum Kaffee von schellackhafter Konsistenz an ihrem Tisch im Wintergarten, den man heute vielleicht mit „shabby-chic“ zu greifen versuchte und seinerzeit vermutlich zwischen Dornröschenschlaf und dem Adjektiv „abgerockt“ hätte einordnen wollen. Der Tisch und die Tante lebten in bewährter Symbiose und ihre seltsam systemübergreifende Einvernehmlichkeit vermochte eine tiefe, unergründliche Würde auszustrahlen.
Tante Elena war ein unerschöpflicher Quell von Witzen, Zoten, Anekdoten und gewährte mir den einen oder anderen Einblick in die wunderbare Welt jüdischen Humors. Nicht diese flachen, zwangsbesinnten Albernheiten, die uns so oft in den gefälligen Hochglanzwellnessfibeln graubärtiger Phantasierabbinern aus Brooklyn sandgestrahlt aufgetischt werden, sondern eher das rauhe, authentische Zeug mit der jahrhundertealten, ashkenasischen DNA aus Schtot und Schtetl. Vielleicht aber auch nur das, was wir dafür halten. Egal. Es wirkt!
Es ist etwa 35 Jahre her, da erzählte Tante Elena mir einen Witz, der bis heute einer meiner absoluten Lieblingswitze bleiben sollte. Darin findet sich ein Streit um den Zeitpunkt, wann Leben entsteht und sie schaffte es, alle drei Buchreligionen in nur wenigen Sätzen auseinander zu nehmen mit einem Notausgang für die jüdische Witwe. Ich werde den Witz hier ganz sicher nicht aufschreiben, weil meine bescheidenen Möglichkeiten bei weitem kaum jemals ausreichen wollen, die Atmosphäre einer gekonnten mündlichen Darbietung mit den passenden Worten an dieser Stelle zu verschriftlichen.
Ich werde den Witz ganz bestimmt auch nicht vorstellen, weil er die sozialen Kanäle heute kaum noch schadlos passieren dürfte, ohne dass man ihn in sinnfrei vorauseilendem Kadavergehorsam als rassistisch kategorisieren und eiligst zurechtstutzen und deformieren würde, ohne sich die Mühe zu machen, zunächst schweigend in die vielschichtige Pointe einsteigen zu wollen.
Die Deutschen, auch die „guten“, sind vielleicht erfolgreich in Uniformität. Uniformität allerdings ist ganz sicher kaum der ideale Nährboden für das uralte Kulturgut Humor. Das Zauberwort heisst Fingerspitzengefühl, das jeder zu besitzen glaubt und dennoch kaum häufiger anzutreffen ist, als die „Blaue Mauritius“.
Was aus Bea und Elena geworden ist, weiß ich nicht. Unsere Spuren haben sich vor vielleicht 25 Jahren endgültig verloren. Von den Witzen sind mir allerdings einige geblieben. Und manche habe ich wiederentdeckt in dem großartigen Buch des ehemaligen ZEIT-Herausgebers Josef Joffe: „Mach dich nicht so klein, du bist nicht so groß!: Der jüdische Humor als Weisheit, Witz und Waffe“ aus dem Jahr 2015. Eine Empfehlung aus vollem Herzen.
Ein ehrliches, herzhaftes Lachen würde vielen, verkniffenen Zeitgenossen gut bekommen, denen man heute ein Stück Kohle in den Hintern steckt, um in wenigen Minuten mit einem Diamanten bedient zu werden.
^ Übersicht ^
02. Von guten Witzen
Als ich eines Spätsommernachmittags in den frühen Achtzigern mal wieder mit meiner Schulfreundin Bea auf der ausladenden Wohnzimmercouch ihrer Eltern rumhing, selbstgedrehte Zigaretten rauchte, süßen Tee trank und auf dem väterlichen Schneewittchensarg im Gedächtnis an Dieter Rams „leise Ordnung der Dinge“ Pink Floyds „Wish you were here“ hörte, schlich von Zeit zu Zeit Tante Elena an uns vorbei, aus ihrem Wintergarten über die hundertjährigen Pitch-Pine-Dielen in die Küche mit dem französischen Landkneipenfliesen und zurück, immer wieder frisch munitioniert mit einer weiteren Tasse schwarzen Kaffees, derer sie täglich Legionen zu absorbieren schien, um als Einfrauantikoffeinkommando den Rest der Welt durch ihre persönlichen Einsatz vor übermäßigen Konsum der gefährlichen Wachmachdroge zu schützen. Durch künstliche Verknappung. Dabei wusste sie beinahe alle ihre Handlungen mit ein paar Worten von Ewigkeitswert, einem Witz oder wenigstens einer groben Zote zu begleiten. Sie schaute nicht einmal auf dabei. Und es störte sie natürlich auch kein bisschen, dass schon wieder mehrere Zentimeter Asche von ihrer filterlosen Camel abzufallen drohten, während in diversen Aschenbechern weitere Exemplare sinnfrei verglimmten. Vermutlich war es ihr nicht einmal bewusst in ihrem Fatalismus, den niemand als organisch oder aufgesetzt zu bewerten wagte. Ich hielt ihn für pathologisch. Das Fundament meiner marianengrabentiefen Sympathien für diese Frau.
„Tante Elena“, sie hatte mich angehalten, sie ebenfalls so zu nennen wie alle anderen auch, das mache die Dinge einfacher und klarer, „Tante Elena, was macht für Dich eigentlich einen guten Witz aus?“ Sie stoppte, blickte an die Raumdecke, zog tief an ihrer Zigarette und atmete eine vernebelte wie vernebelnde Antwort aus: „Einen guten Witz? Das ist eine große Frage.“ Und schlurfte weiter in Richtung Wintergarten. Mit einer fahrigen Handbewegung forderte sie mich sehr lässig auf, ihr zu folgen. Für mich war sie ein Rockstar. Sie sang zwar nicht und spielte auch kein Instrument. Aber Rockstar zu sein, war für mich von jeher eher eine Frage der inneren Einstellung, denn von kommerziellem Output.
Wir saßen nun an ihrem Shabby-Vintage-Wackeltisch, sie schlug ein Bein über das andere, räucherte sich eine ihrer grauschwarzen Locken aus der Stirn und setzte an: „Ein Witz, ein guter Witz, ist ja eigentlich fast immer sowas wie eine kurze Geschichte, eine Erzählung. Meistens ausgedacht. Sie hat eine Struktur. Fast so wie ein Gedicht. Letztlich eine immergleiche Dramaturgie.“ „Du meinst, sie hat immer gleiche Bestandteile?“ „Genau. Ein Witz braucht mehr oder weniger eine Ankündigung, so dass der Zuhörer auch versteht, dass es jetzt lustig werden könnte: Achtung, jetzt geht’s los! Dann kommt die Vorstellung der Situation, der Ort, die Personen, der Plot, wenn Du so willst. Dann kommt die Handlung. Die braucht Raum für Interpretationen. Idealerweise hat sie scheinbar nur eine einzige Deutungsmöglichkeit, weil es sich eben so eingeschliffen hat. und währenddessen baust Du Dir als Erzähler eine zweite Deutungsmöglichkeit auf. Und dann kommt die Pointe. Patsch. Sie ist die Auflösung. Zeigt, dass es eben einen anderen Weg gibt. Die Pointe lebt vom Doppelsinn und der Erkenntnis, dass ein Sachverhalt nicht zwingend einer einzigen Auffassung unterworfen ist. Das wirkt erlösend. Deshalb lacht man.“ „Wollen wir das nicht mal mit einem Witz aus Deinem unerschöpflichen Fundus nachzeichnen?“ „Wir wollen es versuchen. Nehmen wir diesen, einen jugendfreien Klassiker:
„Es kommt eine Flut. Das ganze Land versinkt und der fromme Schmuel bittet Gott, ihn zu retten. Schließlich sei er ja sein treuer Diener und besuche regelmäßig die Synagoge. Da passiert ein Traktor sein Grundstück und man bietet ihm an, ihn mitzunehmen. Doch Schmuel lehnt ab: „Danke, nicht nötig, Gott wird mir helfen.“ Das Wasser steigt. Er klettert also auf das Dach seines Hauses. Es dauert nicht lange und ein Boot tuckert heran. Man will ihn in Sicherheit bringen. Schmuel winkt wieder ab: „Danke, nicht nötig, Gott wird mir helfen.“ Das Wasser steigt unerbittlich. Nun klettert er auf seinen Schornstein, klammert sich fest mit letzter Kraft. Schon kommt ein Hubschrauber angeflogen, der Pilot will ihn mitnehmen. Schmuel kann kaum noch den Kopf über Wasser halten, winkt aber schon wieder ab und meint: „Danke, nicht nötig, Gott wird mir helfen.“ Schließlich ertrinkt er. Kaum im Himmel, trifft Schmuel auf den Höchsten und unterstellt diesem, ihn im Stich gelassen zu haben. Der wird sauer und entgegnet: „ich habe Dir einen Traktor, ein Boot und einen Hubschrauber geschickt. Was also hätte ich wohl sonst noch alles tun sollen?“
„Der hat im Grunde mehrere Pointen.“ „Ja und nein. Er hat vor allem aber noch eine versteckte, die sich so ohne weiteres gar nicht erschließt. Dazu brauchst Du ein bisschen, sagen wir: ‚Insiderwissen‘.“ „Erhelle mich …“ „Gerne. Weißt Du, wir Juden kennen zwar auch diese Bittgebete ‚tu dies und das für mich‘, aber eigentlich bitten wir Gott grundsätzlich nicht um Gefälligkeiten. Wir machen uns mit solchen Witzen lustig über diese Form von bettelnden Stoßgebeten: ‚gib dies, mach das, tue jenes … jetzt sofort für mich allein … auf drei … zackzack‘.“ „Eine Bonusebene? Ein Witz mit VIP-Bereich?“ „Ich sehe das anders. Für mich ist das ein Witz, der allen etwas bietet. Auf jedem Niveau. Das zeichnet einen guten Witz für mich aus.“ „Ja, das ist wohl so.“ Ich schaute aus dem Fenster. Durch die Kastanien ging der Wind. Ich lernte.
^ Übersicht ^
03. Shabbat Shalom
Die Pflanzen wachsen besser, die Hühner legen besser und auch unsereins ist besser dran, wenn nur die liebe Sonne scheint. Der Wintergarten von Beas Eltern war an diesem Freitagnachmittag zwischen spätem Winter und frühem Frühjahr stark lichtdurchflutet, woran auch die rauschenden, majestätischen Kastanien vor der etwas angestoßenen Gründerzeitvilla nur wenig zu ändern vermochten. Die Sonne fand sehr erfolgreich ihren Weg auf unsere Gesichter und in unser Gemüt. Level „skandinavischer Impressionismus“, Serotonin versus Melatonin: eins zu null! So stand es bereits kurz nach Spielbeginn und so sollte es noch ein kurzweilig bleiben. Bea, Tante Elena und meine Wenigkeit saßen um den wackligen alten Holztisch, auf dem sich Zeitungen, Zeitschriften und Bücher in wildem Durcheinander befanden, so wie 3 Kaffeetassen und ein Aschenbecher, der auch als gefährlich vernachlässigte Kreisgiftmülldeponie durchgegangen wäre. Oder als aktiver indonesischer Krater, denn in ihm glimmten mehrere vergessene Zigarettenstumpfe sinnfrei vor sich hin.
Wir lasen vor uns hin und gelegentlich das interessantere vor, als Tante Elena plötzlich innehielt, um zu ihrem Kaffee zu greifen, natürlich eine Camel ohne Filter in der Hand, mit einem Aschekegel, der allen statischen Gesetzmäßigkeiten spottend einfach nicht abfiel, man konnte ihn noch so sehr beglotzen, er wollte einem diesen Gefallen nicht tun.
„Bruno!“ Tante Elena musterte mich durch ihre aberwitzig überdimensionierte Aristoteles-Onassis-Gedächtnisbrille. Cazal. Aus Passau, wie sie mir immer wieder zu versichern wusste. Aristoteles Onassis, Tante Elena und Passau, was für eine Mischung. Die Asche fiel und sie wischte sie beiläufig vom Tisch. „Bruno, schau mich an.“ „Ja.“ Sie tippte mit dem rechten Zeigefinger rhythmisch bestimmt auf den Tisch und erinnerte mich in dieser Geste fast ein wenig an Nikita Sergejewitsch Chruschtschow, wie dieser zur UN-Vollversammlung am 12. Oktober 1960 mit seinem Schuh auf dem Rednerpult herum drosch, um sich die seiner Meinung nach gebührende Aufmerksamkeit zu verschaffen. Sie statuierte:
„Der jüdische Witz nimmt in der Weltliteratur eine Sonderstellung ein.“ Sie war also wieder bei ihrem Lieblingsthema. Und ehrlich gesagt konnte auch ich kaum genug davon bekommen. Sie kannte mich als zuverlässig dünnes Brett, das immer leicht zu bohren war, was ihre zahllosen Anekdoten anging. „Das bezweifelt wohl niemand, Tante Elena.“ „Er ist so viel tiefer, bitterer und schärfer. Er ist dichter und so viel dichterischer als die Witze der anderen.“ Sie zog tief an ihrer Zigarette und blies den Rauch wie eine alte Dampflok nach oben weg, um mich umgehend wieder zu fokussieren: „Ein jüdischer Witz ist niemals nur Witz um des Witzes willen. Immer enthält er eine Kritik, weißt Du?“ Ich nickte bejahend. „Ganz gleich, ob sie religiös ist, politisch, sozial oder philosophisch. Und manchmal ist sie eben auch alles zusammen. Der jüdische Witz ist so oft Volks- und Bildungswitz zugleich. Er ist jedem verständlich und doch voll tiefer Weisheit.“
Wie so oft, war das nur ihre Ouvertüre, ihr Exordium, ihr Startsignal. Sie hatte also wieder einen Witz auf der Pfanne und war sicher noch gespannter als ich, ob sie mir denn wieder einen mir neuen aufzutischen vermochte, einen den ich noch nicht kannte und ihre Quote war brutal. „Also, Abfahrt:“
„Da ist ein Mann.“ „Was für ein Mann, Tante Elena?“ „Lass mich, das tut nichts zur Sache, Bruno, lass mich einfach erzählen.“ „Ok.“ „Da ist also ein Mann. Und der will wissen, ob Sex am Sabbat eine Sünde ist. Er will das unbedingt wissen, denn er ist sich unsicher, ob Sex Arbeit oder Vergnügen ist. Also fragt er einen katholischen Priester nach seiner Meinung: ‚Priester, Priester bitte, ich brauche Deinen Rat. Ist Sex Arbeit oder Vergnügen?‘ Der Priester sucht lange in der Bibel und sagt dann: ‚Mein Sohn, nach meinen ausgiebigen Bibelstudien komme ich zu der sicheren Erkenntnis, dass Sex Arbeit sein muss und somit am Sabbat nicht erlaubt sein kann.‘ Der Mann denkt sich: ‚Naja, was weiß so ein Priester in seinem bescheuerten Zölibat schon von Sex? Keine Ahnung hat der.‘ Also geht er zu einem protestantischen Pfarrer, einem verheirateten Mann. Doch auch aus dessen Bibelexegese ergibt das gleiche, freudlose Fazit: Sex bleibt Arbeit und ist darum, am Sabbat praktiziert, Sünde! Der Mann ist mit den bisherigen Antworten unzufrieden, sucht weiter und befragt also einen Rabbi. ‚Rebbe, lieber heiliger Mann, bitte sagt mir: ‚Ist Sex Arbeit oder Vergnügen?‘ Der Rabbi überlegt reiflich, wiegt seinen grauen Kopf mit dem langen weissen Bart hin und her und sagt schließlich wohl überlegt: ‚Mein Sohn, Sex ist eindeutig ein Vergnügen.‘ Der Ratsuchende stutzt mit großen Augen, ist freudig erstaunt und fragt lieber noch einmal nach: "Rebbe, wie könnt Ihr euch dessen so sicher sein? Alle anderen erklärten mir doch, dass Sex Arbeit sei?" Da antwortet der Rabbi so leise wie weise: ‚Was glaubst Du? Wenn Sex tatsächlich Arbeit wäre, würde meine Frau es vom Hausmädchen erledigen lassen.“
„Shabbat shalom, Bruno“ „Shabbat shalom, Tante Elena, ich liebe den jüdischen Witz.“ „Ich weiß.“
^ Übersicht ^
04. Kein Vergleich
„Bruno, sie ist nicht da.“ „Schade.“ Mir gegenüber stand Tante Elena in der herrschaftlichen Wohnungstür zur gutbürgerlichen Gründerzeitetage von Beas Eltern. Hinter ihr der lange Flur mit den wundervollen, mehr als hundert Jahre alten Pitch-Pine-Dielen. Darauf ein kostbarer Seidenläufer aus dem Orient, links und rechts flankiert von raumhohen Bücherregalen mit einem sehr großzügigen Ausflug quer durch die Weltliteraturgeschichte.
Tante Elena war, eigentlich wie immer, mit einer sehr großen Tasse dampfenden Kaffees ausgestattet, die sie sich wohl soeben in der Küche zubereitet hatte, als ich klingelte. „Willst Du trotzdem reinkommen und mir ein wenig Gesellschaft leisten?“ „Hm, ja und nein. Ich habe gerade hier in der Gegend etwas für meine Mutter erledigt. Ein Botendienst für eine ihrer alten Freundinnen, ziemlich direkt in der Nachbarschaft. Ein Zufall. Da wollte ich die Gelegenheit nutzen und Bea schnell ‚Hallo‘ sagen. Wir haben uns ja einige Zeit nicht gesehen.“ Sie nippt an ihrer Tasse. Beidhändig und beobachtet mich dabei über den Rand: „Du hast wohl Angst, dass ich Dich wieder mit meinen Geschichten verhaften könnte?“ „Ganz sicher nicht. Und das weißt Du ganz genau.“ „Na gut. Dann wenigstens einen auf die Reise? Ein kleine Geschichte to go?“ „Unbedingt.“ Sie zog sehr tief an ihrer Camel ohne Filter, als wolle sie mit dem Glutkegel das ganze Treppenhaus heizen und schon ging die Nummer los.
„Gut gut. Da ist also dieser Rabbi aus Kiryat Hadassa.“ Sie winkt meinen Frageansatz ab: „Das ist im Westen von Jerusalem. Rabbi Menachem ist ein sehr gläubiger Mann. ‚Old school‘ würdet Ihr heute sagen. Wie aus dem Bilderbuch.“ „Schläfenlocken, Rauschebart und so?“ „Das volle Programm. Rabbi Menachem also ärgert sich sehr, dass so viele Gläubige ohne Kippa in seine Synagoge kommen. Er macht sie dafür an, beschimpft sie … keine Reaktion, er verflucht sie, aber es stellt sich keine Besserung ein. Der Rabbi verabscheut es zutiefst, dass die Sitten so verlottern und darum befestigt er schließlich ein Schild am Eingang mit dem eindringlich warnenden Hinweis: ‚Das Betreten der Synagoge ohne Kippa ist ein dem Ehebruch vergleichbares Vergehen.‘ Im Vertrauen auf die Wirkung seiner bedrohlichen Analogie, bettet er sein müdes Haupt und fällt in einen tiefen, erholsamen Schlaf. Am nächsten Tag stellt sich wieder keine Veränderung ein und Rabbi Menachem staunt nicht schlecht als ihn einer der Gläubigen auf seinen Warnhinweis anspricht: ‚Es stimmt nicht, Rabbi. Ich habe es heute Nacht ausprobiert: es ist kein Vergleich!‘
Hahaha, Tante Elena lachte tief und dreckig aus ihrem Raucherkeller, bellte mir noch mit dem groben Humorhusten der Langzeitnikotinjunkies ein freundliches ‚auf bald‘ nach, um ihre verglimmende Kippe zischend in die Kaffeetasse zu stecken und darauf die Tür zu schließen, vor der ich noch immer auf dem Abtreter stand und ihr dabei zuhörte, wie sie den Flur entlangschlurfte und mehrfach wiederholte: ‚es ist kein Vergleich‘… ‚hahaha‘. Immer wieder musste sie über ihre eigenen Worte lachen.
Ich überlegte noch, was ich wohl besser fand, die Tante selbst, oder ihre abstrusen Geschichten. Achwas, beides natürlich. Sie zu trennen, fühlte sich an wie Gin ohne Tonic. Quatsch demnach? Allerdings.
^ Übersicht ^
05. Von Ethik
Es war einer jener schäbigen Donnerstagnachmittage im März 83 oder 84, an denen es draußen stürmte und regnete und man keinen besseren Platz finden konnte, denn auf einer großzügigen Couch. Bewaffnet mit Kissen, Decken, ein paar Zeitungen und Magazinen, dem Album ‚Rumours‘ von Fleetwood Mac, sowie hinreichend Proviant in Form von Kaffee, Keksen und Tabak. Unsere einsame Insel, auf der uns vor allem eins mit der Literaturvorlage ‚Robinson Crusoe‘ von Daniel Defoe verband: das sehnsüchtige Warten auf Freitag. Und das Wochenende, natürlich. Ok, wir konnten uns unterhalten. Immerhin. Der Punkt ging an uns.
Bea und meine Wenigkeit hatten seit ein paar Tagen ein neues Wahlpflichtfach belegt: „Ethik“. Wir konnten sehr gut dabei zuhören, wie ihre neugierigen Eltern sich im Nachbarzimmer darüber unterhielten: „Ethik als Schulfach, was soll das sein?“ „Keine Ahnung, irgend so ein moderner Quatsch, Schnickschnackpädagogik, Experimentalunterricht, 68er-Unsinn, am besten fragst Du mal Deine Tochter oder ihren Komplizen.“ Beas Mutter Sarah war natürlich sehr wohl bewusst, dass wir das Gespräch verfolgten, was aber von unserer Seite nur wenig mit Indiskretion zu tun hatte. Die beiden waren einfach wie immer so laut, dass inzwischen wohl das ganze Haus über unseren neuen Stundenplan informiert sein musste. Bea rollte die Augen: „Oh Mann, Mutter. Ihr seid sowas von peinlich.“ „Wir sind peinlich?“ Sarah betrat sogleich das Wohnzimmer mit einem Glas Rotem in der Hand. Beas Eltern konnten sich nach dem Frühstück keine weitere Mahlzeit ohne feinabgestimmte Weinbegleitung vorstellen. Ich gebe gerne zu, dass ich in diesem hochkultivierten Haushalt hervorragend auf das Leben vorbereitet wurde, auch wenn ich das damals noch nicht immer ahnen wollte.
„Also?“ „Also was?“ „Also, was bedeutet für Euch ‚Ethik‘?“ Inzwischen war auch Tante Elena dazugestoßen, rauchend ‚comme toujours‘ und einen Kaffee hielt sie selbstverständlich auch in der Hand. Sarah bohrte weiter. Und Bea versuchte eine griffige Definition zu finden: „Die Ethik ist ein Teilbereich der Philosophie.“ Ich stieg mit ein und sekundierte: „… da geht es um die Voraussetzungen und die Bewertung von menschlichem Handeln, um ein methodisches Nachdenken über Moral.“ „Und weiter?“ Sarah lachte und schüttelte ihre schwarzen Locken. „Ist das alles? Euer Hemdchen ist doch reichlich kurz.“
„Vielleicht kann ich mich mit einer kleinen Anekdote einbringen und versuchen, den Nebel zu lichten?“ Tante Elena machte ihre typische Geste, mit der sie uns alle versöhnlich in die Arme zu nehmen schien nebst erwartungsfrohem Blick, der uns signalisieren mochte, dass sie uns in wenigen Lidschlägen mit einer famosen Geschichte zu begeistern wusste, denn unser ‘ja‘ war nur allzu selbstverständlich.
„Also gut“, sie zog noch einmal derart tief an ihrer filterlosen Camel, dass sie mich an die ganzkörperbelederten Feuerschlucker auf diesen seltsamen Mittelaltermärkten erinnerte. Als wolle sie alle Glut in sich aufsaugen, um das eigene Feuer ständig aufs neue zu entfachen. Sie stellte Ihre Kaffeetasse auf die Kommode. „Elena“, stönte Sarah, „stell die Tasse doch bitte auf einen Untersetzer, sonst bekommen wir wieder diese Scheißränder auf dem Nussbaum. Danke.“ Tante Elena äffte sie lautlos nach und winkte dabei ab, um mit ausladender Gebärde ihre Worte von Ewigkeitswert anzukündigen.
„Da ist also dieser kleine Jakob. Vielleicht ist er elf, vielleicht aber auch zwölf Jahre alt. Er fragt seinen alten Herrn: ‚Vater, Vater, was bedeutet eigentlich Ethik?‘“ „So wie Sarah …“ „… naja, vielleicht so ähnlich, nur hat der kleine Jakob wirklich nicht die leiseste Ahnung von Ethik. Er hat also seinen Vater nach dem Ethikbegriff befragt. Der entgegnet ihm: ‚mein lieber Junge, Jakob, ich will Dir ein Beispiel sagen. Da kommt also der Grün zu mir ins Geschäft und er will einen Mantel kaufen. Der Mantel kostet sechzig Mark.‘“ „Sechzig Mark? Dafür gibt’s doch keinen Mantel.“ „Unterbrich mich nicht. ‚Der Grün will also einen Mantel für sechzig Mark kaufen. Er probiert ihn an. Der Mantel gefällt ihm ganz ausgezeichnet. Der Grün bezahlt mit einem Hunderter. Ich schlage den Mantel vorsichtig ein und überreiche ihn dem Grün in einer Tasche, begleite ihn an die Tür. Ding Dong. Die Tür ist auf, ich verabschiede den Grün auf dem Trottoir und kehre zurück in den Laden. Kaum stehe ich wieder am Tresen, sehe ich, dass der Grün sein Wechselgeld vergessen hat.‘ ‚Vierzig Mark!‘ ‚Ja Jakob, Du hast gut mitgerechnet, vierzig Mark. Und Achtung, jetzt beginnt die Sache mit der Ethik: soll ich das Geld einfach einstecken, oder wäre es moralisch richtig, es mit meinem Kompagnon zu teilen?‘“
„Hahaha …“ und da war es wieder, dieses unglaublich herzhafte, tiefraue Lachen aus dem Raucherkeller. Tante Elena lachte und hustete und weinte und zuckte, alles zugleich. Und wir alle hatten wieder etwas mitnehmen dürfen. Für immer und für alle Zeit. Vollkommen begeistert. An einem jener schäbigen Donnerstagnachmittage im März. 83 oder 84. Ganz egal.
^ Übersicht ^
06. Die Sicht auf die Dinge
„Warum ärgerst Du Dich, Bruno?“ Tante Elena schenkte mir eine Tasse tiefschwarzen Kaffee ein, der widerspruchslos auch als flüssig kochender Straßenbelag durchgegangen wäre. Dabei musterte sie mich stirnrunzelnd mit ihren hellwachen, ebenso schwarzen Augen durch ihre, jedem Maßstab spottende, gewaltige Aristoteles-Onassis-Gedächtnis-Brille. Sowohl im Aschenbecher, als auch in ihrer rechten Hand glimmten Camel-ohne-Filter-Zigaretten, wie vermutlich noch an diversen anderen Ascheabladeplätzen in der großzügigen Gründerzeitwohnung.
„Also?“ Sie duldete niemals ein Ausweichen, also gestand ich lieber gleich: „ich war mit dem Auto meiner Mutter unterwegs.“ „Hahaha, mit dem Detektiv-Rockford-Auto?“ Da war wieder dieses lastschiffankerkettenrasselnde Lachen, gefolgt von durchdringendem Hustenbellen. „Ja, mit Mutters Camaro.“ „Für Dich als Schüler ist das höchstens peinlich, aber sicher kein Grund zum ärgern. Wolltest Du den Mädchen gefallen?“ „Natürlich nicht!“ „Neiiiiiin, niemals, hahaha. Und?“ „Ich musste ein paar Schulbücher abholen, die ich in der Buchhandlung bestellt hatte. Dafür wollte ich allerdings nicht auch noch teure Parkgebühren bezahlen und zudem vierhundert Kilometer weit laufen …“ „Ich ahne es bereits.“ „… ja, absolutes Halteverbot, Ausfahrt, Feuerwehrdingens … sechzig Mark.“ „Das macht man ja auch nicht.“ „Jaja, blabla.“ „Deswegen musst Du ja nicht gleich pampig werden, dass Du frustriert bist, verstehe ich ja.“ „Entschuldige.“ „Angenommen.“ Tante Elena steckte sich eine weitere Zigarette an und sog den Rauch bis in die allerletzten Verästelungen ihrer Nikotinbelastungsprüfstelle. „Ich würde Dir gerne eine andere Sicht auf die Dinge schenken.“ Ich schaute sie ungläubig an. Was wollte sie mir damit sagen. Sollte das eine rechtmeiernde Lehrstunde werden? Das konnte ich mir kaum vorstellen. Nicht bei Tante Elena. „Wie meinst Du das?“ „Nun, ich hätte da eine kleine Anekdote anzubieten.“ „Hahaha. Super! Genau das brauche ich jetzt!“ „Also los …“
Tante Elena lehnte sich zurück, dehnte und streckte sich und drehte die Augen soweit nach oben, dass ich vermuten musste, sie versuchte in Ihren eigenen Kopf zu blicken, um alle nötigen, vortragsrelevanten Details aufzulesen. Die typische Show, die sie abzog zu vermitteln, sie müsse sich sammeln, um eine ihrer Geschichten zu erzählen. Dabei gehörte das selbstverständlich dramaturgisch zu ihren Nummern wie der Struppi zum Tim.
„Der Grün. Der Grün betritt eine jener großkopferten Glaspalastbanken in Manhattan und fragt umgehend nach dem Geschäftsführer, dem Blau.“ „Das müssen ja riesige Familien sein, soviele Geschichten Du zu den Grüns und Blaus zu berichten weißt.“ „Jetzt halt doch mal die Klappe. Der Grün also erklärt dem Blau, er müsse für eine zweiwöchige Geschäftsreise nach Europa aufbrechen. Dazu benötigte er unbedingt einen Kredit über fünftausend Dollar. Blau sagt ihm, dass ein Kredit keine große Sache sei, dass man für die Summe allerdings schon eine Sicherheit benötigte. Grün willigt ein und bietet Blau seinen hochherrschaftlichen Rolls-Royce an, der direkt vor der Bank auf dem Haltestreifen steht. Blau akzeptiert nach kurzer Prüfung der Papiere, Grün überreicht den Fahrzeugschlüssel und ein Angestellter der Bank setzt sich ans Volant, um das exklusive Automobil in die geldhauseigene Tiefgarage zu fahren und es dort sicher zu deponieren.
Auf den Tag genau zwei Wochen später kommt der Grün wieder in die Bank, zahlt den Kredit von fünftausend Dollar zurück, sowie die Kreditzinsen zu fünfzehn Dollar einundvierzig. Der Blau freut sich: ‚Wir sind hocherfreut, mit Ihnen Geschäfte machen zu dürfen, die Transaktion ist äußerst wünschenswert verlaufen. Nachdem wir ein paar Erkundigungen über Sie eingezogen haben, sind wir allerdings ein wenig erstaunt über den Vorgang an sich und würden nur zu gerne eine Verständnisfrage platzieren.‘ ‚Nur zu‘, sagt der blendend aufgelegte Grün. ‚Wir wissen inzwischen, dass Sie Multimillionär sind ohne jedes Liquiditätsproblem. Warum also um alles in der Welt, leihen Sie sich von uns fünftausend Dollar?‘ ‚Das ist ganz einfach zu beantworten‘, meint da der Grün: ‚Wo bitte kann ich denn schon sonst mein Auto in Manhattan ganze zwei Wochen lang parken für nur fünfzehn Dollar?‘
Ich wurde das Gefühl nicht los, dass Tante Elena mir damit, geistreich wie immer empfahl, mehrere Sichten auf ein und dieselbe Sache zu unternehmen, oder um mit dem deutschen Maler und Kunsttheoretiker Josef Albers zu sprechen: „wage weiter Varianten“. Sie saß mir mit offenen Armen und Händen gegenüber, schaute mich mit großen Augen an und sagte: „Wenn man immer nur durchs Objektiv schaut, bedeutet das noch lange keine objektive Sicht auf die Dinge.“ „Au weia, jetzt wird aber gekalauert.“ „Quatsch.“ „Doch!“ „Nein!“ „Oh!“ Womit wir endlich bei Louis de Funès angelangt waren, für den wir uns beide immer zu begeistern wussten. Einhundertprozent zitatfest.
^ Übersicht ^
07. Ewigkeit vs Unendlichkeit
„… ist dasselbe.“ „Nein, ist es nicht. Jedenfalls nicht für mich.“ „Wo liegt denn dann bitte der Unterschied, Herr Doktor. Und versuche es doch mal auf den Punkt zu bringen.“ Wunderbar, wir hatten also die Sachebene schon fast so scheppernd verlassen, wie Han Solos Millenium Falke die Raumstation Mos Eisley. Trotzdem wollte ich ein allerletztes Erläuterungsexperiment nicht unversucht lassen, meine Sicht auf die Dinge zu artikulieren: „schau mal, Bea …“ „Oh, wie ich es liebe, wenn Du mit mir sprichst, wie mit einer Idiotin.“ „Nein.“ „Doch. Also?“ „Ok, Unendlichkeit bedeutet für mich, dass etwas endlos ist. Das heisst aber nicht, dass es keinen Anfang hat. Vielleicht so, wie das Ding mit dem Urknall. Eine Art Startimpuls und dann Unendlichkeit.“ „Und Ewigkeit?“ „Die hat für mich keinen Anfang und kein Ende. Ewigkeit umgibt alles. Sie ist wie ein in allen Richtungen grenzenloser Teppich, auf dem sich alles abspielt. Sie ist das unerschöpfliche Volumen, in dem dann auch irgendwann der Urknall stattfand.“ „Hm.“
„Worüber debattiert Ihr hier?“ Tante Elena war auf einem ihrer Routinemärsche vom Wintergarten in die Küche zur Proviantaufnahme von frischem Kaffee und einem planmäßigen Aschenbecherwechsel ganz lässig an unserer Wohnzimmercouch gestrandet, so wie jene Weltensegler, die mal eben tiefenentspannt an einer Südseeinsel Halt machen, um mit ein paar schlichten Eingeborenen zu schwätzen, weil es die eigenen Perspektiven verändern könnte.
„Wir versuchen herauszufinden, ob es einen Unterschied gibt zwischen Ewigkeit und Unendlichkeit.“ „Und, zu welcher Erkenntnis seid Ihr gelangt?“ Bea konnte sich in ihrer Geste noch nicht so recht entscheiden zwischen Abfälligkeit und Resignation: „Ich finde, es gibt keinen. Aber Bruno meint, die Unendlichkeit habe, im Gegensatz zur Ewigkeit immerhin einen Anfang, wenn schon beide keinen Schluss finden können.“
„Das ist ein wirklich interessantes Thema. Im Judentum, oder genauer in der kabbalistischen Mystik gibt es den Begriff ‚ain soph‘. Das bedeutet: ‚es hat kein Ende‘. Es steht für die äußerste Wirklichkeit. Sowas wie der Gott jenseits von Gott. Ziemlich komplexer Kram. Ein bisschen wirr, wir wollen uns damit nicht unnötige Kopfschmerzen herbeisinnieren. Einen Denk- und Besinnungsmuskelkater bekommt man da nur allzu leicht, wenn man nicht regelmäßig in der Kabbala trainiert.“ Ich liebte Tante Elenas Metaphern, mit denen sie es verstand, einem auch die entferntesten Themen nahezubringen.
„In Sachen Ewigkeit habe ich eine Anekdote parat.“ Sofort waren wir hellwach. Die mussten wir hören. Wir liebten das. „Sie stammt von Rabbi Abraham Twerski. Abraham Joshua Twerski. Ein chassidischer Rabbi, der auch promovierter Psychiater ist. Zig Bücher hat der geschrieben. Eine echte Ausnahmeerscheinung ist er. Ein sagenhaftes Talent. Haredi. Ultraorthodox. Und trotzdem lebensnah. Twerskis Familie stammte ursprünglich aus Bobowa. Das liegt in Galicien im Süden Polens. Jetzt sind sie alle in Brooklyn.“ „Tante, spann uns bitte nicht auf die Folter, wann kommt endlich die Geschichte?“
Natürlich musste sich Tante Elena erst einmal eine Zigarette anzünden. Dabei ließ sie sich selbstverständlich alle Zeit der Welt, schließlich gehörte auch das zu Ihrer eingespielten Dramaturgie, wie die Butter aufs Brot. Das Ausschütteln des Streichholzes schien allein Stunden in Anspruch zu nehmen. Hin und her und her und hin. Bea verrollte schon Ihre Augen: „Tante!“ „Lass mich, ich bin eine alte Frau und muss mich konzentrieren. Ich will versuchen, alles zusammenzuhalten.“
Wir lehnten uns, ganz entgegen unserer neugierigen Anspannung, nur vermeintlich gelassen zurück. Unser Mätzchen in dem Schauspiel, in dem jeder seine angestammte Rolle zu spielen wusste. So wollte es das Ritual.
„Da ist also dieser Shlomo. Shlomo ist ein sehr glücklicher junger Mann. Er sprüht vor Glück. Und so kommt er eines Tages mit dem Rabbi Halberstam ins vertrauliche Gespräch. Er fragt ihn: ‚Rabbi, Leben ist wunderbar. Ich möchte so gerne ewig leben, was kann ich tun?‘ Der Rabbi wiegt seinen Kopf mit dem schlohweissen Bart, den Schläfenlocken und der typischen Kopfbedeckung sehr lange nachdenklich von links nach rechts und umgekehrt. Dann sagt er: ‚Shlomo, hör mir gut zu. Ich denke, Du solltest heiraten.‘ ‚Heiraten? Wenn ich heirate, werde ich ewig leben?‘ ‚Nein Shlomo, aber der Wunsch wird verschwinden.‘“
Wir explodierten und Tante Elena zog tief an ihrer Camel-ohne-Filter, um sogleich dampfend mit ihrer röchelndrasselnden Brian-Johnson-AC/DC-Lache in unseren Chor einzustimmen. Jetzt hatten wir also auch noch die Relativität von Ewigkeit durchgenommen. Damit konnte vor wenigen Minuten noch keiner rechnen. Licht an einem dunklen Novembertag.
^ Übersicht ^
08. Von Verrat
"Der Grün und der Blau waren nur zwei kleine Ganoven. Hier ein bisschen Trickdiebstahl, da ein wenig Hehlerei. Nichts großes, gerade genug, um über die Runden zu kommen. Und obwohl sie seit vielen Jahren dasselbe Viertel, die selben Wochenmärkte, Geschäfte und Kaufhäuser bearbeiteten, lernten sie sich doch erst wirklich kennen, als sie in flagranti ertappt, verhaftet und verurteilt wurden und künftig für eine lange Zeit dieselbe Zelle im selben Gefängnis teilen sollten.
Das Gefängnis war ein furchteinflößender, düsterer Backsteinbau aus der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Die Gänge, die Zellen: nass, kalt und dunkel. Muffig. Dort angekommen, stand in dem winzigen, in dunklem Grau gestrichenen Raum neben einem Tisch, zwei Stühlen, einem kleinen Schrank und dem Eimer für die Notdurft ein rostiges Eisenstockbett, über dessen Belegung eine Münze des stiernackigen Wärters entscheiden sollte. Der Mann, der keine Widerworte kannte und sich seiner Wirkung selbstgefällig wohl bewusst war, warf also sein Geldstück in die Luft und alle drei verfolgten wie gebannt die Auf- und Abwärtsbewegung und den kurzen Augenblick am Scheitelpunkt, an dem die Welt nur für einen kurzen Moment stehenzubleiben schien, um sie mit der rechten Hand sogleich wieder aufzufangen und klatschend auf seine linke zu schlagen. Kopf für das obere Bett, Zahl für das untere. Blau hatte Kopf, der Grün die Zahl. Kopf lag oben. Es war entschieden.
Neben dem oberen Bett befand sich ein schmales Kippfenster in der meterdicken Außenmauer. Gerade groß genug, um liegend hindurchzuschauen. So gerne hätte der Grün das Bett neben dem Fenster gehabt. So gerne hätte er hinausgeschaut. Aber die Münze hatte entschieden und Grün traute sich auch nicht das Angebot des Blau anzunehmen, es sich wenigstens hin und wieder für ein paar Stunden dort bequem zu machen und den Ausblick zu genießen. Zu groß war sein Respekt vor dem Wärter und dessen Helfern und Zuträgern. Und vor den angedrohten Sanktionen.
Der Blau schämte sich seines Glücks und er wusste sich nicht besser zu helfen, als dem Grün zu berichten, von dem was er da sah: den nahegelegenen Park, das Licht, die Farben, ferne Geräusche und eine Idee von den Jahreszeiten. Von den Frauen und ihren Kleider und wie sie sich bewegten. Der Grün lag in seinem Bett und zehrte sich. Tag ein, Tag aus. So ging es ansonsten einvernehmlich viele Jahre. Man hatte sich eingespielt und aneinander gewöhnt, war beinahe freundschaftlich verbunden.
Irgendwann kam es in dem Zellenblock zu einer Revolte. Grün und Blau beteiligten sich nicht daran. Und dennoch wurden auch sie befragt, denn man wollte alle wenigstens gedanklich Involvierten identifizieren, um sie mit einer deutlichen Haftverschärfung zu belegen, auf dass sehr schnell und für sehr lange Zeit Ruhe einkehrte. Die Aussagen der Zinker sollten diskret behandelt werden, um sie in ihrer Zuarbeit den anderen Häftlingen nicht zur Bestrafung auszuliefern.
Die Wärter wusste um Grüns Sehnsüchte nach dem Bett am Fenster, das hatte sich inzwischen lange herumgesprochen und die Zeiten waren sogar schon fast wieder vorbei, in denen sie sich darüber lustig machten. Nun warfen sie das Bett als Privileg in die Waagschale für den gewünschten Meineid. Nein, er würde den Blau nicht noch einmal sehen müssen. Und nein, niemand sollte von diesem niederträchtigen Verrat je erfahren.
Zurück in seiner Zelle, lernte der Grün seinen neuen Mithäftling kennen. Einen primitiven, grobschlächtigen Mann, der wegen einiger schwerer Gewaltdelikte für viele Jahre einsitzen sollte. Auch wegen Missbrauchs, wobei er vorgeblich keinen Unterschied machte zwischen den Geschlechtern. Der Wärter war noch in der Zelle, als er schon die ersten anzüglichen Gesten andeutete.
Der Grün nahm also seine Decke und zog vom unteren Bett ins obere. Sein Verrat steckte ihm so tief in den Knochen wie die böse Vorahnung dessen, was nun kommen sollte. Er war ein bisschen in die Jahre gekommen und der Aufstieg fiel im nicht ganz so leicht wie erhofft. Grün musste sich erst von der einen Seite auf die andere drehen, um endlich und nach all den langen Jahren aus dem kleinen Fensterschlitz blicken zu können. Seine Erlösung. Und er sah eine Backsteinmauer. Keine 3 Meter entfernt und genau gegenüber. Nicht mal ein bisschen Himmel, kein Licht und keine Farben. Kein Park und schon gar keine Frauen. Er hörte, wie sich die Zellentür hinter dem Wärter schloß. Und er spürte, wie sein Leben augenblicklich an ihm vorüberzog.“
Tante Elena lehnte sich zurück, steckte sich eine ihrer filterlosen Zigaretten an, zog den Rauch tief ein bis in die hintersten Winkel ihrer leidgeprüften Lunge und musterte uns in diesem Augenblick absoluter Stille.
^ Übersicht ^
09. Von Chuzpe
Bea erzählte mir wenig diskret von einer Unterhaltung ihrer Eltern, die kaum streitlos miteinander, aber erstrecht nicht ohne den anderen leben konnten. Levi hatte wieder irgendetwas ausgefressen. Beas Vater wusste sein Leben zu genießen und verfügte dazu über ein extrem loses, aber geschultes und im Wortschatz ausgesprochen reiches Mundwerk, das ihn zu einem grandiosen Conferencier machen konnte oder eben auch zu einem üblen Zotenreisser, was beides in Ordnung ist, solange man sich den Ort, die Zeit und das jeweilige Publikum zu vergegenwärtigen vermag. Diese Fähigkeit kam Levi allerdings regelmäßig mit steigendem Rotweinumsatz exponentiell abhanden. Und genau darum ging es wohl auch diesmal, wofür Levi selbstverständlich eine in sich logisch klingende Erklärung fand, die Sarah so nicht durchgehen lassen wollte. „Levi, Du kannst einem Rabbi von beinahe neunzig Lebensjahren nicht solche Geschichten erzählen.“ „Warum nicht, es hat ihn doch sichtlich belebt?“ „Was ihn belebt hat, war nicht Dein Witz, sondern ein glücklicherweise anwesender Mediziner, der ihm half, die Fassung wiederzufinden.“ „Aber irgendwie war ich ja schon daran beteiligt …“ Dafür erhielt Levi von Sarah die Chuzpe-Spange in Gold, mit Edelsteinen dekoriert und die gelbrote Karte mit Aussicht auf getrennte Schlafzimmer. Fürs erste.
‚Chuzpe‘ - das ist ein tolles Wort, fand ich. Es ist eines jener typischen Worte aus dem Jiddischen, das für so viele Dinge steht und das sich doch nicht ganz so leicht greifen lässt. „Was bedeutet Chuzpe für Dich“, fragte ich Bea. Ich hörte im Hintergrund das knitternd knattrige Geräusch einer Zeitung, die augenblicklich zusammengefaltet wurde. Das war das übliche Signal. Tante Elena hatte uns, natürlich rein zufällig, gehört und machte sich bereit, in unseren Dialog miteinzusteigen. Das bot ihr neben der willkommenen Gelegenheit des Austauschs eben auch den Rahmen, endlich mal wieder eine ihrer filterlosen Fluppen anzustecken, aus der zweiten oder dritten Schachtel des Tages, wer wusste das schon so genau, und einen rabenschwarzen Kaffee nachzugießen.
„Also?“ „Also was?“ „Bruno hat Dich doch was gefragt?“ „Jahaaa. Frechheit vielleicht. Und Respektlosigkeit möglicherweise. Unverschämtheit? Dreistigkeit? Da fehlt noch was, richtig?“ „Was meinst Du, Bruno?“ „Ich finde Unverschämtheit treffend. Aber unbedingt intelligent. Dreist, ein bisschen unwiderstehlich. Anmaßend auf jeden Fall. Auch witzig?“ Tante Elena sog tief an ihrer Camel, um mit dem auszustoßenden Qualm auch gleich noch ihre Worte freizulegen: „Da gibt es ein sehr schönes Buch über den jüdischen Witz. Es stammt von der Schriftstellerin Salcia Landmann, eine galizische Jüdin aus Żółkiew in der Nähe von Lemberg. Ihre Leute sind allerdings schon vor dem ersten Weltkrieg in die Schweiz gezogen.“ „Du kennst die Biographien immer ziemlich genau.“ „Nur wenn sie mich interessieren.“ „Ihr Buch ist aus den frühen Sechzigern. Sie hat auch einige Kritik dafür bekommen, weil die Leute zu blöd waren, ‚Judenwitze“ und ‚jüdische Witze“ auseinander zu halten, aber pauschal Alarm gaben. Und das ganz furchtbar genau. Manchmal waren das sogar dieselben Leute, die das auch mit unserer Deportation ganz furchtbar genau nahmen. Keine zwanzig Jahre vorher. Egal, zurück zu ihrem Buch. Darin fand Salcia ein ausgezeichnetes Beispiel für den Begriff ‚Chuzpe‘, das heute quasi Standard geworden ist.“ „Die Nummer mit dem Mord?“ „Ja, genau die. Es geht in etwa so: ‚Chuzpe ist, wenn einer Vater und Mutter erschlägt und im Plädoyer seines Mordprozesses mildernde Umstände verlangt, weil er ja nun elternlose Vollwaise sei.“
„Hahaha, wie geil …“ „ja, ziemlich. Es gib da allerdings einen Unterschied in der Bewertung des Begriffs. Im Jiddischen steckt da immer noch irgendwo und irgendwie Anerkennung mit drin. Da geht es um sowas wie Auflehnung gegen Konventionen. Bis zum letzten. So ähnlich jedenfalls. Im Hebräischen ist das Verständnis von ‚Chuzpe’ eher negativ besetzt. Da versteht man das als Grenzverletzung von Anstand oder Höflichkeit, um die eigenen Bedürfnisse durchzusetzen. Eine Ego-Veranstaltung. Gar nicht gut.“
„Und Du, wie siehst Du das, Tante Elena?“ „Unsere Leute stammten ja ebenso aus Galizien. Ashkenasim. Wir lachen gern. Manchmal bitter. Aber immer noch gern. Der Rabbi Walter Rothschild aus Wien hat mal gesagt: ‚Man muss nie vergessen, Lachen, Humor, ist eine Waffe der Schwachen, der Machtlosen. Man fühlt sich machtlos, desto mehr braucht man Humor.‘“ „Tante, hast Du vielleicht auch eine Anekdote zum Thema ‚Chuzpe‘?“ „Lass mich kurz nachdenken, ich glaube schon.“ Sie nahm noch einen Schluck von dieser bittersauren Plörre, die sie Kaffee nannte und sich aus der schäbigen Thermoskanne nachgeschenkt hatte , ohne die man sie eigentlich nirgends antreffen konnte, zog eine weitere Zigarette aus der knittrigen Schachtel, um die mit einem Streichholz anzustecken, dass nur so die Funken flogen. Sarah hatte immer Angst, dass sie eines Tages noch das ganze Haus anzünden würde, aber Tante Elena entgegnete salopp, dass das ja nicht einmal die Scheißnazis geschafft hätten.“ Pause. Dann legte sie los.
„Ok, da ist also dieser Bettler, der da draussen auf der Straße rumlungert. Das sieht eine Hausfrau durch ihr Küchenfenster. Der Bettler tut ihr leid. Sie bittet ihn also herein und gibt ihm etwas zu essen. Auf dem Tisch steht ein großer Brotkorb voller Schwarzbrot. Und außerdem steht da noch ein großer Teller mit ein paar Scheiben Challe …“ „Was ist ‚Challe‘?“ „Das kennst Du, Bruno. Hast Du schon oft bei uns gegessen. An Shabbat oder Feiertagen, Das geflochtene Weißbrot.“ „Ahja, ich wusste nicht, wie es heisst.“ „… der Bettler stürzt sich also prompt auf die Challe, worauf die Hausfrau vorsichtig meint: ‚hey, wir haben auch Schwarzbrot‘. Der Bettler entgegenet: ‚ich esse aber eigentlich viel lieber Challe‘. Sie wendet ein:‚aber, guter Mann, die Challe ist doch sehr viel teurer!‘ … und er anmerkt: ‚aber das ist sie ja auch wert, gute Frau!‘ … hahaha. Ok, ich merke schon, der war Euch zu brav.“
„Naja, nein, so ist es nicht, Tante Elena. Ich finde ihn nur nicht so richtig chuzpemäßig. Frech ja, aber Chuzpe?“ „Ich glaube, ich verstehe, Bea. Dann will ich mal versuchen, den Unterschied besser herauszuarbeiten: Stell Dir also vor, Du kämst mal überraschender Weise früher nach Hause und fändest dort Deinen Freund textilfrei in den Armen Deiner allerbesten und ebenso unbekleideten Freundin vor. Und das in Deinem Bett. In Deiner Wäsche. Mit Champagner. Aus Deinen Gläsern. Du musst zugeben: das wäre eine absolute Frechheit.“ „Allerdings!“ Bea blickte sehr überzeugend drein. „Natürlich reagierst Du sauer. Drehst auf, schreist rum. Wenn dir aber Dein Freund auf Deine Empörung hin entgegnete, du solltest dir an der Performance Deiner besten Freundin mal ein Beispiel nehmen, dann wäre das Chuzpe …“
„Oha.“ Wir alle mussten herzhaft lachen und ich denke, wir sind dank Tante Elenas Anekdoten und lebensnahen Analogien auch an diesem Nachmittag in Sachen Begriffsanalyse mal wieder einen bemerkenswerten Schritt weitergekommen.
^ Übersicht ^
10. Déjà-Vu
Wir alle kennen diese seltsamen Augenblicke, in denen man vermeintlich schon einmal Erfahrenes wiederholt durchlebt. Ein solches „Déja-Vu“ bezeichnet man in der Psychopathologie als ‚qualitative Gedächtnisstörung‘ und die ist eine Erinnerungstäuschung oder sogenannte Bekanntheitstäuschung. Die Franzosen sind in der Bezeichnung dieses psychologischen Phänomens schon etwas genauer. Sie unterscheiden in ein „Déjà-écouté“ beziehungsweise „Déjà-entendu“ für ein „schon gehört“, in ein Déjà-vécu für „schon erlebt“ und ein „Déjà rêvé“ für „schon geträumt“ beziehungsweise „schon mal vorgestellt“ oder „eingebildet“.
Und mit dem „Déjà-écouté wäre am besten gegriffen, was mir kürzlich widerfahren ist. Da saß ich also mit einem Kunden im Gespräch, oder vielmehr mit jemandem, der ein ebensolcher hätte werden können. Ein Mensch, der in seinen Routinen gefangen ist, weil alles schon immer so war, darum wohl immer so bleiben muss und dem ich gerne mit einem Perspektivwechsel geholfen hätte, seine unternehmerischen Befindlichkeiten neu zu sortieren. Es ging gar nicht mal um den ganz großen Spagat, wie disruptive Innovationen und all dieses neumodische Zeug. Eher darum, Vorhandenes anders zu besehen, zu bewerten und dann vielleicht neu zu ordnen, um künftig besser bestehen zu können. Und das auch in Zeiten von Krisen.
Ich konnte so viel erzählen und erklären wie ich wollte, Bilder formen, Analogien bilden, Metaphern bemühen: selbst als ich schon fast ein Ziel zu erkennen glaubte, ernüchterte mich mein Gegenüber mit einem Statement, das uns gefühlt eher noch vor den Start zurückkatapultierte, als auch nur einen Meter vorantrieb.
Als ich mich in meiner aufpilzenden Verzweiflung zurücklehnte und meine Gedanken in der losen Anordnung der Lochung der Akustikdecke im Loft unserer Agentur zerstreute, war es plötzlich da: das nur vermeintlich trügerische Gefühl, schon einmal im Dialog an genau dieser Verständnishürde gescheitert zu sein. Mitausgeliefert wurde mir ein Hoffnungsschimmer, denn damals vor über 35 Jahren, löste mir die geistreiche Tante Elena meiner Schulfreundin Bea die sisyphossche Herausforderung und meine Erklärungsnot auf mit einer humorvollen Anekdote in historischer Dimension.
Wir saßen damals im Wintergarten der herrschaftlichen Gründerzeitwohnung von Beas Eltern. Bea und ich spotteten resignierend über die Verhaltensschleifen eines gemeinsamen Bekannten und dessen Erkenntnisstarre. So kam es, dass wir irgendwann schließlich auch Tante Elena darüber berichten mussten, denn natürlich hatte sie das eine oder andere Stichwort vernommen und sie trug die Neugier voller Stolz als zweiten Vornamen.
„Mich erinnert das alles an einen großartigen Dialog den man Ben Gurion und Pinchas Rosen nachgesagt hat. Natürlich ist das nur ein Witz, aber wer weiß das schon so genau. Ihr wisst, wer das ist?“ „Ben Gurion klar, aber Pinchas Rosen?“ „Das war der erste israelische Justizminister …“ Tante Elena schenkte sich aus ihrer reichlich ramponierten Thermoskanne, heute würde es ‚vintage‘ heissen, einen Kaffee nach, der vielmehr an ein hochgiftiges Industrieöl erinnerte, denn an ein menschenverzehrfähiges Genussmittel. Dazu steckte sie sich eine weitere ihrer zahllosen filterlosen Zigaretten in den Mund und zündete die mit großer, fahrender Geste mit einem Streichholz an. Es waren immer nur Streichhölzer, ich habe Tante Elena nie ein Feuerzeug benutzen sehen. Die Kippe brannte wie die Lunte an der Tante, die Glut leuchtete hellrot, sie sog tief ein und mit dem Qualm kam auch schon die Geschichte:
„Ihr müsst wissen, der Pinchas Rosen stammte aus Deutschland. Und Ben Gurion aus Polen. Vielmehr aus dem sogenannten Kongreßpolen, was zum russischen Kaiserreich gehörte, aber das führt jetzt zu weit. Rosen fragt also Ben Gurion: ‚sag mal, warum lacht Ihr Ostjuden eigentlich immer über uns Jeckes?‘ ‚Das will ich Dir gerne erklären‘, verspricht dieser und sucht zu diesem Zweck gemeinsam mit Rosen den Laden eines anderen Jecke auf. Jecke sind die Westjuden, aber das habt Ihr ja sicher schon begriffen, richtig?“ Wir nickten so synchron wie Esther Williams Badenixen schwammen. „Gut gut. Ben Gurion und Rosen stehen also im Laden von dem Jecke und Ben Gurion verlangt nach einer Schachtel Streichhölzer. Kaum hält er diese in seinen Händen, öffnet er sie und meint, er hätte gerne eine Schachtel, in der die Hölzer andersherum liegen. Der Jecke öffnet also ein paar Schachteln und meint, die würden alle in der gleichen Richtung liegen. Nichts zu machen. Es ist wie es ist. Danach nimmt Ben Gurion Rosen mit in den Laden eines galizischen Händlers. Ihr wisst, wo Galizien liegt?“ „Ja, Tante Elena, Deine Heimat.“ „Ganz genau. Ben Gurion verlangt wieder nach Streichhölzern und beanstandet auch diesmal die falsche Lage. Der Galizier dreht unter der Theke den Inhalt einer weiteren Streichholzschachtel um und meint, er könne vielleicht helfen. Er habe da einst unter schwierigsten Bedingungen eine Sonderanfertigung auftreiben können. Sogleich macht er sich scheinbar auf die Suche und wird, oh große Überraschung, schließlich fündig. Er sei vielleicht bereit, diese sehr besondere Schachtel abzutreten, müsse aber fünf Prutot mehr berechnen … ‚Sie verstehen sicher‘. Ben Gurion wendet sich an Rosen und sagt: ‚Verstehst Du jetzt, was ich meine?‘ Darauf entgegnet Rosen: „Aber das war doch bitteschön reiner Zufall, dass der Galizier noch diese eine, besondere Schachtel hatte …“
Hahaha, was war das wieder für eine großartige Geschichte. „Ja genau, darum geht es, Deine Anekdote ist ganz wunderbar, Tante Elena.“ „Dann erzähle sie Deinem verständnisgebremsten Bekannten, vielleicht geht es ja so, Bruno.“ „Ja, vielleicht.“
Und auch diesmal will ich es genau so wieder versuchen.
^ Übersicht ^
11. Schnaps
Tante Elena durchquerte auf ihrem Weg von der Küche in den Wintergarten das Wohnzimmer mit einer weiteren Thermoskanne ihrer tiefschwarzen, sauren Filterkaffeeplörre. Schlurfend, rasselnd, qualmend wie eine dieser kolonialen indischen Schmalspurdampfloks in den Höhenlagen von Darjeeling, die noch immer die Verbindung schaffen zwischen Dörfern, Städtchen und Plantagen, zwischen Mensch und Mensch und dem Tee. Ähnlich verrußt und ähnlich alt. Und auch das mit der Verbindung passte ja irgendwie.
Sie zog dabei ihre Camel ohne Filter so hart durch, als wolle sie die Beerendekoration eines Wodkalondrinks durch den Strohhalm saugen. Kurz bevor sie unser Sofa erreichte, gingen in der Küche die Streitereien von Beas Eltern in eine weitere Runde. Die Tante stoppte, verdrehte die Augen und imitierte tonlos mit schamlos übertriebener Grimmasse und Gestik gleich beide Zankenden in einer extrem gelangweilt vorgetragenen Doppelrolle, indem sie mit dem Wechsel des jeweils Maulenden, den Kopf mit wehendem Haar einfach nach links oder nach rechts drehte.
„Worum geht es, Tante? Worüber streiten sie denn schon wieder?“ „Ach was weiß denn ich, Pack verschlägt sich, Pack verträgt sich.“ „Achwas, Tante Elena, sag schon.“ „Ich glaube, Dein Vater Levi will heute nochmal ausgehen.“ „Ja und? Das wäre ja nicht das allererste Mal, dass er abends nochmal raus muss.“ „Aber Deine Mutter will nicht.“ „Muss sie doch auch nicht. Sie geht doch auch sonst nicht immer mit.“ „Ich glaube diesmal ist es so, dass Sarah gar nicht will, dass er überhaupt geht.“ „Hm.“ Die Tante drückte ihre Zigarette in den Aschenbecher auf der Kommode, nicht ohne sich vorher eine neue daran angezündet zu haben. Der tiefe Zug verursachte prompt einen leichten Hustenanfall. „Tante, Du bringst Dich um mit Deinen Sch*ißzigaretten.“ „Ja, aber immerhin bringe ich mich selbst um, was in meiner Mischpoke ja leider nicht immer selbstverständlich war.“
Bea verdrehte die Augen und ich musste mich beherrschen, nicht augenblicklich loszulachen über die unverschämte Coolness dieser besonderen Frau mit dem Humor eines japanischen Damaszenermessers. „Levi hat es wie immer idiotisch angefangen.“ „Hä? Wie meinst Du das?“ „Nun, dazu gibt es eine schöne Geschichte aus dem Schtetl. Wollt Ihr sie hören?“ „Unbedingt.“ „Kennen wir sie noch nicht?“ „Ich glaube nicht Bea, lass es uns versuchen.“
„Ok, die Geschichte geht also so: der Jankel liegt abends im Bett bei seiner Frau. Er ist unruhig, dreht und wendet sich und meint schließlich: ‚Rifke, mir ist gar nicht gut. Bitte, hast Du einen Schnaps für mich?‘“ „Rifke?“ „Jah, Rifke. Die erwachende Rifke also will ihren Ohren nicht trauen und hakt mürrisch nach: ‚habe ich Dich richtig verstanden? Du fragst mich mitten in der Nacht nach einem Schnaps?‘ ‚Ja, Rifke, bitte, mir ist nicht gut, bitte hast Du einen Schnaps für mich?‘ ‚Ich hab keinen Schnaps, Jankel. Los, schlaf weiter!‘ ‚Rifke bitte, es ist ja nicht so, dass ich unbedingt einen Schnaps haben muss, aber vielleicht hat ja der Nachbar welchen?‘ ‚Bist Du vollkommen wahnsinnig geworden? Ich werde doch jetzt nicht unseren Nachbarn wecken, nur um Dir einen Schnaps zu holen?‘ ‚Rifke, bitte nicht so laut, Du weckst noch die Kinder auf. Und es ist ja nun wirklich nicht so, dass ich unbedingt Schnaps bräuchte, aber vielleicht könntest Du eben schnell in die Stadt gehen und mir einen Schnaps aus der Kneipe holen?‘ ‚Jankel, ich glaube, Du hast Dein restliches bisschen Verstand verloren. Wie kommst Du nur auf solche Ideen? Du kannst nicht wirklich glauben, dass ich mitten in dieser kalten Winternacht jetzt hier aus meinem warmen Bett steige, um durch den Schnee zu stapfen und Dir einen Schnaps zu holen?‘ ‚Schschhhhht! Hör doch auf mit Deiner Schreierei. Du weckst noch das ganze Haus auf. Denk doch auch mal an die Kinder. Glaubst, ich wäre so verrückt nach Deinem Schnaps. Aber nein, Du willst nicht gehen. Na … dann gehe ich eben selber!‘“
„Hahaha Tante Elena, dieser Jankel macht mich wahnsinnig, aber ich glaube, Papa könnte eine Menge von ihm lernen.“ „Ja Bea, allerdings, er könnte eine Menge lernen von all diesen Jankels, aber Levi hört eben einfach nie zu. Dabei gibt es die meisten Antworten lange schon vor den eigentlichen Fragen.“
^ Übersicht ^
12. Zeugnisausgabe
Beas Vater Levi war nicht das Problem. Er hatte das Punktesystem in Sachen Schulbenotung ohnehin nie wirklich verstanden. Vermutlich interessierte es ihn nicht einmal. Ganz Fatalist, schienen ihm die Fügungen des Schicksals unausweichlich und mit menschlichem Willen war dem auch nichts entgegenzusetzen.
Bei der Mutter Sarah lagen die Dinge etwas anders. Sie war das Bollwerk zwischen der Zeugnisausgabe und den letzten möglichst entspannten Schulsommerferien, bevor es im Herbst auf die Zielgerade zum Abitur gehen sollte. Vier Punkte in Biologie würde sie bei ihrer Tochter niemals folgenlos verwinden können. Als ob die jemals eine Rolle für Beas Karriere hätten spielen können. Die durchgehend zweistelligen Ergebnisse in den alt- und fremdsprachlichen Disziplinen sowie auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften konnten da allerdings nur wenig ausgleichen, denn Sarah hatte einen erheblich ehrgeizigen Blick auf die Zukunft ihrer Tochter und suchte in der eine Universalgelehrte heranwachsen zu erkennen, ein Zahn, den ich ihr in puncto Naturwissenschaften bereits nach der allerersten gemeinsamen Chemiestunde schon vor Jahren hätte ziehen können.
Egal. Das Zeugnis war da und da hatten wir auch schon den Salat. Schreierei im Hause Hoffmann. Ich wollte Bühne und Szene umgehend verlassen, aber Sarah sah in mir wohl den adäquaten Zeugen ihres selbstgerechten Tribunals, was selbstredend lächerlich sein musste, da natürlich niemand besser um unsere schulischen Begabungen und Interessen wusste als ich selbst. Und nein, nur weil wir in Biologie damals nicht alle Pokale abzuräumen vermochten und nicht auf die Shortlist des Nobelpreises zu geraten drohten, wären wir vermutlich dennoch nicht auf der Straße gelandet als „Laubfeger“, „Bierkutscher“ oder „Stundenmädchen“. Rückblickend kann ich jedenfalls festhalten, dass ausnahmslos alle bedrohlichen elterlichen Prognosen nicht eingetreten sind. Nicht einmal die dunkelsten, die uns für den Rest unseres Lebens eine Achterbahnfahrt durch die Apokalpypsen eines Hieronymus Bosch ankündigen wollten.
Auf seiner Flucht vor der Familientragödie, die sich in der Küche abzeichnete, ist Levi dann im Wintergarten wohl auf Tante Elena getroffen, die sich gerade auf den entgegengesetzen Weg machen wollte, um ihre zerbeulte Thermoskanne mit einer weiteren Einheit der sauren, schwarzen Plörre aufzuladen, die sie als Kaffee zu bezeichnen pflegte. Während sie ihren Zigarettenstummel im Aschenbecher mehr vernichtete als ausdrückte, blickte sie Levi über ihren Brillenrand aufmerksam an und vernahm die warnenden Hinweisen, die sie weniger aufhalten als vielmehr noch anzutreiben vermochten: „geh nicht dahin, bitte, lass es sein!“ “Von wegen Freundchen, jetzt erstrecht!“
Schon platzte sie mitten ins Geschehen: „was ist denn hier los?“ Sarah rollte mit den Augen und verkündete umgehend den kurz bevorstehenden, gesellschaftlichen Niedergang des Hauses Hoffmann: „Deine Großnichte, meine nichtsnutzige Tochter entehrt uns noch alle! Sie reitet alles in den Dutt. Haben wir uns dafür so geschunden? All die Entsagungen …“ „… die liegen wohl eher in Deiner Literaturbegeisterung begründet, Eurer schrulligen Buchhandlung und Deiner Eigenart, die Ware Deinen Kunden exklusiv nach unterstellter Eignung zuzuteilen. Da haben Dir Deine einstigen, guten Zensuren in Mathematik auch kaum helfen können. Denn rechnen kannst Du offensichtlich trotzdem nicht …“ „… im Laden geht es um Betriebswirtschaft …“ „… ach, papperlapapp.“
Tante Elena steckte sich eine weitere ihrer endlosen Camel ohne Filter an, die sie aus der Seitentasche ihres Salonmantels fingerte und zog so tief durch, als wollte sie ihre Fluppe gleich auf einmal erledigen: „Ich glaube, ich habe da eine passende Geschichte für Euch parat.“ Und prompt verklappte sie eine gewaltige Rauchwolke. „Natürlich!“ Bea und ich erahnten schon die sich öffnende Lücke im Zeit-Raum-Kontinuum. Sarah stöhnte und ihr aufgesetztes Schielen deutete ihre stark begrenzte Begeisterung für diese unabwendbare Ablenkung an: „also los, wenn es nicht anders zu gehen scheint.“ „Du könntest ruhig ein bisschen mehr Begeisterung und Dankbarkeit aufbringen für meine Anekdoten als Ausdruck Deiner eigenen kulturellen Wurzeln.“ Tante Elena betrachtete sie streng, nicht ohne uns zwischendurch lässig zuzuzwinkern. Diese Frau war eine Bank. Unbezahlbar.
„Der Cohn steht vor Gericht.“ „Das war klar, immer dieser Cohn.“ „Gar nichts ist klar, Sarah.“ „Also gut, der Cohn steht also vor Gericht. Er hat gepanschten Wein verkauft. Und er verteidigt sich selbst: ‚sehr geehrter Herr Richter, verstehen Sie etwas von Chemie?‘ ‚Nein‘, sagt der, ’warum sollte ich? Ich bin Jurist.’ Dann fragt der Cohn den Gutachter: ‚sehr geehrter Gutachter, wertgeschätzter Experte, verstehen Sie etwas von Gesetzen?‘ ‚Nein‘, meint der, ’ich bin doch Chemiker.’ Da wendet sich der Cohn wieder an den Richter und statuiert: 'verehrter Richter, und von mir armem, einfachem Juden erwartet Ihr, dass ich mich in beidem auskenne?’
Euch allen schöne Ferien!“
^ Übersicht ^
13. Sprechtag
„Nein, das hat sie nicht. Das ist nicht wahr. Bitte Kind sag, dass das nicht stimmt?“ Sarah saß am Küchentisch und hielt ihr schönes Gesicht in beiden Händen begraben, nicht ohne es hin- und herzuwiegen und dabei rhythmisch mit dem Fuß aufzustampfen. „Aber ja doch Mutter, Tante Elena war in der Schule. Ich habe es aber nicht von ihr selbst, sondern von unserem Biologielehrer erfahren.“ „Was wollte sie denn da?“ „Na, ich nehme an, sie wollte an den vier Punkten im Zeugnis drehen, wegen derer Du mich enterben mochtest und mich hast bereits im Aldi Regale einräumen sehen. Beinahe hatte Dein übersäuerter Magen erst sich selbst und dann Dich gleich in Gänze mitverdaut.“ „Die Tante hatte mir aber auch ganz schön eingeschenkt. Über unseren schönen Buchladen hat sie hergezogen, der uns doch alle ernährt.“ „Hat sie nicht. Und das weißt Du. Sie hat die Dinge ins Verhältnis gesetzt und wollte nur schlichten.“
„Was hat er gesagt?“ „Wer?“ „Na, Dein Lehrer. Was hat sie getan? Sie hat doch hoffentlich nicht einen ihrer Sargnägel geraucht?“ „Einen? Eine halbe Packung, Mutter. Was denkst Du? Der Lehrer hat sogar zugegeben, dass er irgendwann aufgab auf ein Verbot zu insistieren und ab da einfach mitgeraucht hat. Und Kaffee haben sie getrunken. Weil er es sicher nicht könne, hat natürlich sie den gekocht. Drei Löffel pro Tasse. Eine einfache Faustformel, wenn man weiterkommen mag …“ „Ohje. Und jetzt?“ „Nix ‚und jetzt‘: er war begeistert. Ist sich aber heute wohl nicht mehr ganz sicher, ob er wegen des heftigen Nikotin- und Koffeinmissbrauchs halluziniert habe, oder ob das alles wirklich so verhandelt wurde.“ „Was hat sie ihm erzählt?“ „Etwas von kulturellen Wurzeln und von Identität. Es ging wohl um Verständnis, Toleranz und diese Dinge. Darum, auch mal etwas anzunehmen.“ „Was hat das mit Biologie zu tun?“ „Die Frage habe er sich auch gestellt. ‚Alles und nichts‘, meinte wohl die Tante und zu der Einsicht sei er inzwischen auch gelangt.“ „Ach.“
„Natürlich habe sie ihm eine Geschichte erzählt und damit eine Art Gleichnis gegeben, Du kennst sie ja.“ „Weißt Du genaueres?“ „Aber ja, der Lehrer war so begeistert, dass er mir alles minutiös wiedergeben wollte.“ „Jetzt spann mich nicht unnötig auf die Folter.“ „Ok, es begann wohl mit dem Exodus der Ashkenasim in den dreissiger und vierziger Jahren in die Neue Welt und besonders nach Brooklyn. Wer das ist, warum und wieso und sie habe ihm auch den Unterschied erklärt zu den Sefardim. Sie hat ihm berichtet, dass es die ostjüdischen Familien anfangs ganz schön schwer gehabt hätten und dennoch die alten Schrifttumskenntnisse haben retten wollen, indem sie Melamdim beschäftigten, ihre Söhne zu unterweisen …“ „… vielleicht solltest Du Deinem Freund Bruno kurz erklären, was Melamdim sind …“ „… das weiß der schon, oder?“ „Ja Bea, Tora- und Talmudslehrer, so in etwa.“ „Ja in etwa.
Tante Elenas Geschichte handelt vom Verstecken. Sie geht so: ‚vor den Melamdim beziehungsweise vor dem Melamed, also dem Lehrern verstecken sich die Schüler. Dann, wenn es ans Bezahlen geht, verstecken sich die Väter der zu schulenden und wenn die Väter hören wollten, was die Söhne denn so gelernt hätten, verstecken sich schließlich die Lehrer selbst.‘“
„Hahaha, unsere Tante ist großartig.“ „Allerdings, das erkannte wohl auch unser Lehrer, der meinte, die Geschichte für sich selbst begreifen und annehmen zu können.“ „Oh, das ist ein Zeichen von Größe.“ „Ja, das fanden wir auch. Auch wir sehen die Dinge jetzt etwas anders.“ „Dann hat es wohl doch etwas genutzt.“ „Ja, unbedingt.“
^ Übersicht ^
14. Schein und Sein
„Worüber streitet Ihr?“ Tante Elena stand in der verglasten Doppeltür zum Wintergarten und schaute uns eindringlich an. In der rechten Hand trug sie wie gewohnt ihre zerbeulte Thermoskanne, die sie scheinbar soeben in der Küche mit ihrer schwarzsauren Industrieplörre frisch aufgeladen hatte. Links einen schwer abgenutzten Hochleistungsaschenbecher, dessen Inhalt sie offensichtlich auf demselben Weg verklappt hat, um der nächsten Packung ihrer unendlichen ‚Camel ohne Filter‘ den gebührenden Raum zu schenken. Die erste daraus steckte bereits hellglühend im Durchzug in ihrem Mund in Ermangelung einer dritten Hand. Mangelnde Effizienz konnte man ihr kaum vorwerfen. Die Tante hasste überflüssige Wege.
„Wir streiten uns nicht wirklich“, meinte Bea. „Nein, Du machst Dich nur lustig über meine neue Sitznachbarin, die Du verdammt spießig findest, ohne sie überhaupt zu kennen.“ „Rieche ich hier etwa buttersaure Eifersucht?“ „Nein, Tante Elena, hier ist niemand eifersüchtig. Und nein, ich stehe auch nicht auf unsere neue Mitschülerin, nur weil ich die gegen Beas Vorurteile verteidige.“ „Ein bisschen?“ „Nein, auch kein bisschen!“ „Was ist mit ihr? Bea, weißt Du genaueres?“ „Das brauche ich gar nicht, das sieht jeder sofort. Allein, wie die schon angezogen ist. Und wie die spricht.“ „Oh Mann.“ „Bea, das ist tatsächlich ein bisschen dünn. Weißt Du, man sagt nicht umsonst, Vorurteile seien die hässlichen Kinder der Unwissenheit. Seit wann ist sie bei Euch?“ „Sie kam gestern in unsere Klasse. Ist aus Süddeutschland. Landei.“ „‚Grüß Gott‘ ist schon ziemlich beknackt.“ „Das sagen die halt so.“ „Jaja, das ist ja lächerlich. Was kommt als nächstes? Heil Hi*ler?“ „Spinnst Du?“
Tante Elena hob beide Hände und blickte dabei stumm nach unten auf die Zeitung vor sich auf dem Tisch. Das war ihr Signal, unseren Redefluss zu unterbinden. Dann schaute sie über den Rand ihrer Aristoteles-Onassis-Gedächtnisbrille, ‚Cazal‘ aus Passau wie sie uns immer wieder stolz zu berichten wusste, und uns ernst an: „Ich habe eine kleine Anekdote für Euch. Es geht um ‚Schein und Sein‘, aber ich will Euch nicht langweilen mit meiner präsenilen Salbaderei.“ „Wie könntest Du uns jemals langweilen, Tante? Bitte, wir brennen lichterloh.“ Sie zündete sich eine weitere Zigarette an, obwohl die letzte noch im Aschenbecher vor sich hin glimmte: egal, jetzt hieß es, nur nichts durcheinander zu bringen. „Ich vernehme den Spott in Euren unbedarften Stimmchen. Aber soll ich Euch was verraten? Das ist mir Schnuppe. Und wenn ich die Nummer nur deshalb erzähle, damit ich sie selbst nicht vergesse.“ „Sei doch nicht beleidigt, Tante Elena. Du weißt, dass wir Deine Geschichten lieben.“
„Na gut. Ihr wisst ja beide, wo ich herkomme und wo die Wurzeln von Beas Familie liegen. In unserem Schtetl gab es einige Geschäfte. Manche hatten sogar ein Schaufenster und im Schaufenster von Shlomo Finkelstein, zumindest so ähnlich hieß er, lag eine Uhr. Ein ortsfremder Kunde betrat also diesen Laden und befragte den Ladenbesitzer - Shlomo war einer jener bärtigen, alten Juden in typischer, einfacher osteuropäischer Bekleidung - nach dem Preis des guten Stücks. Der erklärte sogleich, dass er gar keine Uhren verkaufe. Sein Kunde war bass erstaunt und mochte sich erkundigen, warum dann dieser Chronometer in seiner Auslage läge. ‚Ja‘, erläuterte Shlomo freundlich, ‚Ihr habt recht. In meinem Schaufenster liegt eine Uhr. Aber es ist nicht immer alles wie es scheint. Wißt Ihr, ich bin der Beschneider unserer Kultusgemeinde. Was bitte glaubt der Herr, soll ich denn in meinem Schaufenster präsentieren?‘“
Tante Elena lachte schon mit den letzten Worten ihrer Geschichte brülllaut los und man konnte in ihrem Gewitterlachen mühelos den jahrzehntelangen Nikotinmissbrauch und die zahllosen Filterlosen diagnostizieren. Eine nach der anderen. Ihr stand das Wasser in den Augen: „Ich nehme an, Ihr habt alles verstanden?“
„Allerdings!“ Bea und ich schauten uns an. Konnte das sein? Hatte Tante Elena soeben tatsächlich das Auftreten unserer neuen Mitschülerin mit der werblichen Kommunikation der Circumcision in ihrer alten Gemeinde in Vergleich gebracht? So unglaublich wie verständlich? Genau das verhalf regelmäßig zu einer ganz neuen Sicht auf die Dinge.
^ Übersicht ^
15. Prince “live”
„Bea, was ist los mit Dir?“ „Sie ist beleidigt.“ „Kann sie nicht mehr selbst antworten, Bruno?“ „Scheiße!“ „Aha?“ Tante Elena nahm Platz am wackligen Wintergartentisch. Direkt gegenüber von Bea, die sie über den Rand ihrer grotesk überdimensionierten Aristoteles-Onassis-Gedächtnisbrille fest fixierte. Die Tante war eine der wenigen Menschen die ich bis auf den heutigen Tag kennenlernen durfte, die diese bizarre Brille tatsächlich würdevoll tragen konnten und können. „Cazal sagte sie immer stolz. Aus Passau, das wissen nur die allerwenigsten. Nix Paris, New York, Mailand, scheiß drauf, Passau macht es!“
„Bea, also, raus mit der Sprache, was ist Scheiße?“ „Sarah …“ „Sarah ist Scheiße?“ „Nein.“ „Das wäre ja auch noch schöner. Sarah ist Deine Mutter.“ „Ja, aber …“ „Aber was?“ „Sie verbietet mir ständig alles mögliche.“ „Wir beide wissen, dass das Quatsch ist.“
Tante Elena lehnte sich zurück und zog den riesigen, zerbeulten Blechaschenbecher an sich heran. Sie fingerte eine ihrer unzählbaren täglichen Camel ohne Filter aus einem der vielen Päckchen, die sich wie bei jedem Leistungsraucher aus der Olympiaklasse ständig in Griffweite befinden mussten, entflammte sie mit einem dramatisch überformatigem Kaminholz, um sie augenblicklich vermeintlich bis zur Hälfte gierig zu inhalieren. Eigentlich brauchte sie das Feuerzeug ja gar nicht, denn sie hätte mühelose die immernächste Zigarette an der immerletzten entzünden können. Wahrscheinlich sogar rund um die Uhr in einer Art unendlichen kosmischen Schleife. Denn ich habe in all den Jahren nie erlebt, dass sie schlief. Ganz gleich zu welcher Uhrzeit ich bei Bea aufschlug, die Tante war da und sie rauchte beharrlich.
„Was hat sie Dir also verboten?“ Tante Elena neigte den Kopf zur Seite, um eine bemerkenswerte Wolke entweichen zu lassen, ohne uns unmittelbar kontaminieren zu müssen. „Sie will nicht, dass ich auf ein Konzert gehe.“ „Das kann aber nicht alles sein, denn vorletztes Wochenende warst Du auf einem Konzert, zu dem sie Dir sogar die Karte gekauft hatte.“ „Ja, aber …“ „Was aber?“ „Das war total langweilig und diesmal darf ich eben nicht.“ „Und warum?“ „Naja, das Konzert findet an einem Sonntag statt.“ „Und?“ „Abends …“ „…weiter …“ „… spät …“ „Hm.“ „In Hamburg.“ „Oh!“ „… und ich habe auch nur eine Karte.“ „Ok, ich kann Deine Mutter ein bisschen verstehen.“ „Prince.“ „Oh, toll.“ „Den kennst Du?“ „Klar, nur weil ich alt bin, bin ich ja nicht gleich meschugge. Wie hast Du es angestellt?“ „Was angestellt?“ „Na, wie hast Du sie gefragt?“ „Ich habe gesagt, Prince kommt nach Deutschland, ich konnte eine Karte ergattern, das Konzert ist dann und dann, da und da, normal halt.“ „Das war idiotisch!“ Bea blähte die Backen bei weit aufgerissenen Augen. „Du musst Dich jetzt nicht künstlich aufregen. Du hast Dir die Suppe selbst eingebrockt. Ich habe Dich für intelligenter gehalten.“ „Jaja, Du kannst leicht kluge Reden schwingen.“
„Ich möchte keine Reden schwingen. Aber ich würde Euch gerne eine kleine Anekdote erzählen, in der alles ist, was man für solcherlei Ansinnen im Leben wissen muss. Wollt Ihr?“ „Klar wollen wir.“ „Du auch, Bruno?“ „Ja unbedingt.“ Die Tante goß sich eine Tasse ihrer tiefschwarzen, sauren Industrieplörre ein aus ihrer reichlich demolierten Thermoskanne, die sie fast immer bei sich trug. Als Startsignal steckte sie sich eine weitere Zigarette an, während die Überreste der vorangegangenen im reich gefüllten Aschegrab verglommen.
„Also gut. Da sind also ein paar Jewische-Studenten. Ihr wisst was das ist. Sie debattieren. Ob man beim Gemore-Lernen rauchen darf oder besser nicht.“ „Was ist ‚Gemore‘, Tante?“ „… der Talmud, es geht um den Talmud …“ „Ah.“ „Die jungen Männer fragen sich also, ob man wohl beim Talmud-Lernen rauchen darf, aber sie kommen zu keinem Ergebnis. Darum gehen sie zum Rebbe und der erste fragt gleich: ‚Rebbe, darf man beim Gemore-Lernen rauchen?‘ ‚Auf keinen Fall‘, entscheidet dieser vollkommen entrüstet. Der zweite fragt den ersten, wie man denn bloss so plump fragen könne. ‚Mach’s doch besser‘,kontert da der erste. ‚Aber sicher‘, meinte der zweite und spricht: ‚Rebbe-Leben, sagt, darf man auch beim Rauchen den Talmud studieren?‘ ‚Aber ja, natürlich“, entscheidet der Rebbe voller Begeisterung darum, dass der fleissige junge Mann selbst beim Rauchen noch den Talmud studieren möchte.“
Und wie so oft, brach Tante Elena über ihre eigenen Geschichtchen in schallendes Gelächter aus, das in einen gefährlich rollenden Husten überging, der ihr die Augen aus dem Schädel zu treiben drohte: „Haha, ich hoffe, Ihr habt mich verstanden?“ „Ja Tante, das haben wir. Wir waren vielleicht idiotisch, aber wir sind ja nicht vollkommen verblödet.“ „Hoffentlich …“ „… Dankeschön.“
^ Übersicht ^
16. Die richtige Frage
„Na, so ein A*schloch!“ Bea schüttelte sich vor Lachen: „Bruno, das ist wirklich zu schön, wie Du Dich über diesen Id*oten aufregen kannst.“ „Ist doch wahr! Hat eine Quelle für die Prüfungsfragen aufgerissen und will uns nicht sagen wo und von wem.“ „Da musst Du Dich nicht wundern, Ihr schaut Euch doch seit Jahren kaum mit dem A*sch an.“ „Aber das ist schon was anderes, es geht ja auch nicht nur um mich.“ „… es ist die Rache des kleinen Mannes, er fühlt sich endlich auch mal obenraus.“ „Ach Sche*ße!“
Plötzlich steht Tante Elena im Raum. Die Haare etwa wirr, kaum gebändigt durch ihre Brille, die sie sich auf ihre klassisch hohe Stirn geschoben hatte, mit der sie in der Renaissance auf jeden Fall manchen Preis gewonnen und einige Portraitmaler um ihren Verstand gebracht hätte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es bereits erwähnte, aber sie trug immer die legendäre „Cazal 607“, worauf sie verdammt stolz war. Denn die hatte ihr einst der Firmeninhaber und Chefdesigner Cari Zalloni höchstpersönlich geschenkt, als sie sich mal in Passau zufällig begegnet waren. Eine Geschichte, die sie nie müde wurde zu wiederholen. Um es abzukürzen: Sie habe das perfekte Cazal-607-Gesicht, meinte Zalloni. Und bei Gott, er hatte recht.
Tante Elena schaute mich an und steckte sich dabei eine ihrer zahllosen Camel-ohne-Filter-Zigaretten in den Mund, um diese sogleich mit einem wütend aufflammenden Kaminstreichholz anzuzünden. „Los, raus damit, was blökst Du hier rum, Bruno?“ „Er ist sauer auf einen Mitschüler, einen ziemlichen Deppen.“ „Sag mal Bea, kann der Bruno nicht mehr selbst antworten? Braucht er jetzt schon eine Pressesprecherin?“ „Du bist heute aber auch schon früh auf Krawall gebürstet.“ „Naja, zum einen ist mein Kaffee aus. Und zum zweiten geht mir euer Gezeter ganz schön auf die Nerven. In Kombination fällt das unter die Genfer Konventionen. So eine Art Gelbkreuz für meine Gelassenheit.“ „Au weia. Also los.“ „Ok, Tante Elena, wir haben da diesen Idioten in der Klasse, der tatsächlich die Prüfungsfragen hat …“ „… die er Dir nicht geben will und auch den anderen nicht, weil ihr eben nicht miteinander auskommt.“ „So ungefähr.“ „So ungefähr?“ „Naja, er will uns nicht mal sagen, woher er sie hat. Welches Buch und wo das zu beschaffen ist.“ „Und wie habt Ihr ihn gefragt?“ „Na wie wohl: woher hast Du die Fragen, Id*ot!“ „Hahaha, das ist vielleicht ehrlich, aber eben auch ehrlich meschugge. So konnte das ja nichts werden.“ „Das wissen wir ja nun auch.“
Bea war inzwischen in die Küche gegangen, um die zerbeulte Thermoskanne der Tante mit ihrer bittersauren Industrieplörre neu aufzuladen, die diese tatsächlich als Kaffee zu bezeichnen pflegte. Kaum zurück, tippte Tante Elena in schneller Folge mit ihrem Zeigefinger unmissverständlich auf ihre Tasse. Bea gehorchte augenblicklich, schielte dabei allerdings einen Tick zu lange in Richtung Zimmerdecke. „Spinnst Du, Fräulein?“ „Äh!“
„Ich würde Euch gerne eine Geschichte erzählen.“ „Lass uns raten, es geht ums Fragen.“ „Ganz recht. Es geht darum, wie man wem, wann und wo die richtige Frage stellt.“ „Wir sind ganz Ohr, Du hast wie immer unsere ungeteilte Aufmerksamkeit.“
„Also gut, da ist also ein Chassid aus Ljubawitschi, was heute im russisch-weissrussischen Grenzgebiet liegt. Bruno, Du weißt, was Chassidim sind?“ „Ja, Tante Elena. Zumindest so ungefähr.“ „Dieser Chassid ist ein Reisender und ist also nach Bels gefahren, um dort Geschäfte zu machen.“ „Wo ist Bels?“ „Bea, Bels ist eine kleine Stadt in der Oblast Lwiw im Westen der Ukraine, nahe der polnischen Grenze. Galizien, meine Heimat, Deine Wurzeln.“ „Wie hieß der Chassid, Tante?“ „Das tut nichts zur Sache. Nachdem der jedenfalls seine Geschäfte über Gebühr erfolgreich erledigt und sein Nachtgebet gesprochen hatte, wollte er sich mit einer entspannenden Visite bei den Chónten belohnen.“ „Tante, ‚Chónten‘ habe ich noch nie gehört. Was ist das?“ „So nannten wir die leichten Mädchen, Dirnen, Huren …“ „… ein Chassid?“ „Was denkst Du?“ „Er kannte sich in Bels nicht gut aus und wusste nicht, wo das Hurenhaus zu finden war. Er traute sich aber auch nicht, direkt zu fragen. Wie hätte das ausgesehen? Ein vornehmer Chassid mit langem Bart und Péjeß, ganz wie es sich gehörte.“ „… und jetzt geht es darum, wie man wem, wann und wo die richtige Frage stellt?“ „Versau es nicht. Der Chassid dachte also lange nach und blickte sich auf den kleinen Straßen um, bis er einen anderen, hochvornehmen Chassid entdeckte, um den zu fragen: ‚Vetter, bitte sagt mir: wo wohnt Euer Rabbi, er soll leben?‘ ‚Gleich da drüben‘, entgegnete der Angesprochnene und zeigte auf das schlichte, schmucklose Gebäude: ‚das ist das Haus unseres Wunderrabbis.‘ ‚Oh je, Ohjemine‘, zauderte da der Mann aus Ljubawitschi, ’der Rabbi wohnt direkt neben dem Bordell?’ ‚Ja, bist Du denn verrückt geworden?‘ rief da der Belser, rot vor Zorn: ‚ich habe Dir doch eben gesagt, dass unser Rabbi gleich dort drüben wohnt, nur wenige Schritte. Und das Bordell, das liegt da hinten …‘ und er drehte sich um voller Abscheu, mit dem Finger darauf zu weisen.“ Und die Tante brach in ihr lawinenartig grollendes Gelächter aus, das ganze Häuser mitzureissen drohte. Wir stimmten ein: „ich denke, wir haben verstanden.“
^ Übersicht ^
17. „die Sicht auf die Dinge“
Ich weiß nicht mehr genau, wie wir darauf kamen, wahrscheinlich haben wir es irgendwo gelesen und plötzlich war die Geschichte da: „Das Wunder der Anden“ von der Rettung einer uruguayischen Rugbymannschaft, die 1972 während einer Flugreise von Montevideo nach Santiago de Chile in den Hochanden abgestürzt war und von der nach unglaublichen zweiundsiebzig Tagen immerhin sechzehn Mitglieder gerettet werden konnten, nachdem sie bereits lange aufgegeben worden waren. Bea verrollte die Augen und intonierte Katja Ebstein: „Wunder gibt es immer wieder …“ „Bitte, bitte, aufhören, bitte!“ Flehend faltete ich meine Hände und ging bereits in die Knie.
Eine Verkettung von unglücklichen Umständen, eine absurd fehlerhafte Navigation, schlechte Witterungsbedingungen und falsche Entscheidungen führten in eine Katastrophe, eine Havarie im Hochgebirge auf knapp viertausend Metern Höhe in extrem unwirtlichen Bedingungen. Und da waren da eben eine Gruppe verdammt robuster Burschen, die den Crash überlebt haben, Rugbyspieler, die als erfolgreiches Team zusammenzuhalten wussten und ein paar mutige und auch unkonventionelle Entscheidungen getroffen haben. Nachdem bereits nach wenigen Stunden die knappen Vorräte an Keksen, Schokolade und Rotwein aufgebraucht waren, hat man sich mit einiger Überwindung an den tödlich verunfallten Reisegefährten bedient. Profaner Kannibalismus. Das kann man ekelhaft finden und dennoch eine Notwendigkeit darin erkennen, wenn man alle Sinne beisammen hat. Diejenigen in der besten Verfassung brachen irgendwann auf, um Hilfe zu holen, was schließlich auch gelang. Helden? Ja, sicher. Wunder? Wir sahen uns an und bestätigten uns gegenseitig das Gefühl sich aufdrehender Zehennägel.
Wir taten uns sehr schwer damit. „Wunder? Was soll das überhaupt sein?“ „Naja, ich glaube, es findet immer gerade dann Verwendung, wenn die Leute sich etwas nicht erklären können.“ „Übernatürlich, metaphysisch, religiöser Schwurbel, Hokuspokus.“ „So ungefähr und vielleicht doch nicht ganz. Wunder beschreiben möglicherweise das Volumen eines Raums, den das Wissen noch offengelassen hat.“ „… und das sieht jeder sowieso ganz anders …“
„Worum geht es?“ Tante Elena schlurfte eine ihrer Routinerunden durch die etwas angestossene großbürgerliche Wohnung von Familie Hoffmann auf dem Weg vom Wintergarten in die Küche oder zurück. So genau hatte ich es diesmal nicht mitbekommen. Es ging letztlich immer darum, neuen Kaffee zu holen oder das, was sie dafür hielt. Mit ihrer Rechten hatte sie die zerbeulte Thermoskanne fest im Griff, in der Linken glimmte eine der zahllosen Camel-ohne-Filter, mit denen sie tagein, tagaus ihren Atemapparat torpedierte wie General Patton ‚44 die deutschen Truppen bei Avranches.
„Also?“ Sie blickte eindringlich. „Wir sprechen gerade über Wunder.“ „Und? Zu welchem Ergebnis kommt Ihr?“ „Alles ziemlicher Mumpitz. Erklärungsfutter für die Schlichteren unter uns.“ Die Tante zog ihren Stummel rotglühend, wiegte ihren schwarzgrau bemähnten Kopf hin und her und meinte, es käme wohl immer auch auf die Perspektive an: „Für mich ist das Wunder vielleicht eine Art Erlösung aus Wunsch und Hoffnung. Man muss nicht alles erklären und will vielleicht auch nicht immer alles erklärt bekommen.“
„Sicher hast Du eine Anekdote für uns …“ Tante Elena blickte mich fordernd an über den Rand ihrer Aristoteles-Onassis-Brille. „Ganz schön vorlaut. Sei’s drum. Hier kommt die Geschichte, wenn ihr mögt.“ „Unbedingt, ja, bitte.“
„Genau so ist es passiert: der Rabbi und der Blau sind zusammen unterwegs auf einem alten, knarrenden Pferdefuhrwerk. In einer frühen Sommernacht, die Luft ist angenehm, nicht zu warm, aber auch nicht kalt und über der fahrenden Gesellschaft spannt sich ein klarer Sternenhimmel. Ein fabelhafter Moment. Der alte, eingespannte Zosse sorgt für ein gemütliches Tempo und damit reichlich Zeit, sich zwischen den Dörfern über die Dinge zu unterhalten, die die Welt bedeuten. Die Bedingungen sind ideal. Der Rabbi wäre kein echter Rabbi, wenn er nicht die Gelegenheit nutzte und so geht es recht bald um die übernatürlichen Ereignisse. Er fragt den Blau: ‚Blau, wenn Du eine stumme Frau hättest und die würde wegen eines Rabbis plötzlich anfangen zu sprechen, sag, würdest Du an ein Wunder glauben?‘ Der Blau denkt nach, reibt sich den Kopf und entgegnet: ‚Rabbi, nein, aber wenn meine Frau plötzlich verstummen würde, dann schon.“
Explosionsgelächter. „Die Sicht auf die Dinge.“ „Eine Frage der Perspektive …“ „… ja, das ist es wohl immer. Irgendwie.“
^ Übersicht ^