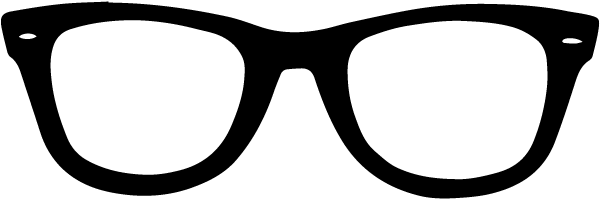München ohne Münchner
In Capriccio bejaunert der Schreiber Martin Zeyn sein offenkundig desolates Verhältnis zum Münchner Oktoberfest im stereotypen Klagelied der zugezogenen Akademiker. Die Medien verorten seine Person als etablierten Kulturjournalisten und genau in diesem Selbstbewusstsein und den daraus erwachsenden Ansprüchen des Universalsichtigen finden sich womöglich die Wurzeln seines Ungemachs als Cocktail aus wesensbedingt verpflichtender Grundablehnung und vielleicht tatsächlich ein bisschen Störung, die im Laufe der Jahre und in der Routine des sich im Kreise seinesgleichen verselbständigten Mantras zur alljährlichen Apokalypse epischen Ausmaßes anschwellen durfte. Seine soziale Echodruckkammer wird ihr übriges beigetragen haben zu einem immer ausgefeilteren Narrativ, das nun endlich seine Verschriftlichung fand.
Das ist ihm nicht gut bekommen, dem Narrativ. Denn zwischen der Rede und ihrer Kolumne entstehen Lücken. Während die wütige Salbaderei in ihrem Fluss so manche ihrer Leerphrasen gnädig überhören und durchgehen lässt, verführt sie gedruckt zum Stocken und wiederholten Nachlesen und fügt sich daraus zu einem eingeschränkten, holzschnittartigen Bild, das sich mit den Realitäten einfach nicht decken will.
Die Leier der zugezogenen Anwohner, die gegen die unerwartete Ruhestörung eines Oktoberfestes zu Felde ziehen, erinnern an die Hamburger Medienhipster, die unbedingt die gentrifizierten Straßenzüge auf St. Pauli bevölkern müssen für das plakative Lokalkolorit und dann hysterisch die Schattenseiten einer Reeperbahn und deren Wurmfortsätze beklagen, die scheinbar plötzlich und wie aus dem Nichts auftauchen.
Hey Idioten: you can‘t eat the cake and have it.
Wenn ich mich recht entsinne, dauerte das Oktoberfest bislang noch keine vollen zwölf Monate an. Man muss also nicht mühsam das quälende Bild trauriger Kinderaugen konstruieren, von lustigen Papierdrachen die nie mehr steigen dürfen, wo eine Armee internationaler Partyorks für alle Zeiten ihr düsteres Säufermordor schaffen und alles Gute und Schöne in ihrem Erbrochenen zu ersticken trachten.
Auf die wahrscheinlich etwas kurzgesprungene Idee einer Schieflage zwischen Einnahmen und Ausgaben zu Ungunsten des Veranstaltungsortes und seiner Protagonisten werde ich nicht dezidiert einsteigen. Nur soviel: man kann nicht einerseits von Kommerz schwafeln und tatsächlich annehmen wollen, dass sich dieser nicht lohne. Zum Kapitalismus im Festtagskleid habe ich schon viel erfahren in meinem unbedeutsamen Leben, allerdings nie, dass ihn sich jemand leiste, nur um exklusiv ein paar feinnervige Kulturschaffende zu martern. Die ökonomische Karte sollte man nur dann spielen, wenn sie wirklich sticht. So und so.
Nein, ich bin kein Volksfestgänger und habe es geschafft, zeitlebens alle Großveranstaltungen weiträumig zu umfahren. Dennoch scheinen diese einem nicht unerheblichen Teil der Gesellschaft zu gefallen. Andererseits bin ich ziemlich sicher, selbst Marotten mitzubringen, die eben auch von anderen mal ausgehalten werden. Ein einvernehmliches Miteinander ist immer ein Geben und Nehmen, das Prinzip des pluralistischen Wesens unserer Demokratie.
Ich halte wenig von der subjektiven Formulierung eindeutiger Verhältnisse. Par ordre du mufti. Weil einer weiß, was gut für alle ist? Meine Welt ist viel zu klein, als dass alle darin platznehmen könnten. Und weil ich daraus glaube ahnen zu können, was ich für ein Designer bin weiß ich, was andere Leute für Ärzte, Ingenieure, Fliesenleger oder eben Kolumnisten sind: sicher keine Universalgelehrten mit Allgemeinheitsanspruch. Und das nicht mal in ihrer Nische.
Darum ermüdet uns bitte nicht weiter mit diesen sedierenden Plattitüden um die gestörten Kreise empfindsamer Kunstbeschreiber. Die Künstler selbst haben lieber gefeiert. Zu allen Zeiten. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Grantelnde Misanthropie kann originell sein. Nur muss sie dazu auch originell sein und nicht das erwartbare Absingen des immergleichen Liedes, dem Medienbauschaum im September anlässlich der Wiesn:
oans, zwoa, gsuffaa.