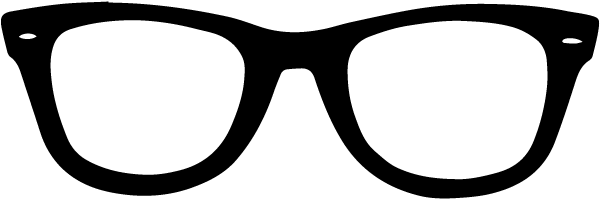Tatort Tatort
Nachdem ich gestern reichlich Bewegung an der frischen Luft und jede Menge rheinhessische Spätsommersonne genossen hatte, lag ich abends rechtschaffen erschöpft auf meiner Couch. Zu erschöpft, um noch aufmerksam zu lesen, oder ein anspruchsvolleres Fernsehprogramm auszuwählen. Also ergab ich mich in das sonntägliche Schicksal vieler Millionen Volksgenossen zur kollektiv sedierenden Tatortbestrahlung. Und in der Erfüllung all meiner Vorurteile gegen das Format, wurde meine vorangegangene Gleichgültigkeit gegenüber meiner sonntagabendlichen Unterhaltung hart abgestraft.
Schon sehr oft habe ich mir die Frage gestellt, warum die Skandinavier inzwischen so viel bessere Kriminalfilme machen als die Deutschen. Vielleicht liegt es in der Entstehung der Geschichten begründet. Während in Kopenhagen, Oslo, Stockholm oder Helsinki ein trockener Mord Ausgangspunkt der Story ist, um den oft ohne jede Berührungsängste mit politischen Befindlichkeiten spannende Handlungsstränge entstehen dürfen mit interessanten Charakteren. Die Kunst der Skandinavier liegt im Auslassen.
Tatortautoren funktionieren anders. Die wählen sich gerne ein allzugut abgehangenes, vermeintlich gesellschaftsrelevantes Thema aus den Vorvorvorjahrsarchiven der Premiumprintmedien, formen daraus einen Telekolleg „political correctness“, würzen zur Authentizitätsbezeugung mit ein paar Schlagworten aus dem Aktivistenumfeld und garnieren das Ganze mit einem an den Haaren herbeigezogenen, abstrus konstruierten Tötungsdelikt, das den Zuschauer unterstützen soll, die beschulten Inhalte leichtgängiger zu verdauen. Fachleute nennen das „Edutainment“. Ein wesentliches Problem dieser Chimären liegt wohl darin, keiner der ursprünglichen Aufgaben mehr gerecht werden zu können. Betrachten wir die Vorbilder aus der griechischen Mythologie, wird schnell klar, warum der Zentaur schon an den einfachsten Aufgaben wie der konventionellen Morgentoilette scheitern musste. So ähnlich verhält es sich beim Tatort, der uns eigentlich mit Spannung durch den Ausklang des Wochenendes begleiten möchte und doch nur bräsig zeigefingert.
Diesmal hieß das penetrierte Stichwort „Femizid“ und das „Incel“-Sujet war Frameset. Ein Glück, dass das öffentlichrechtliche Budget nur eine Tote zuließ, so blieb uns ein deutscher Anders Behring Breivik mit seinen inflationären siebenundsiebzig Opfern erspart. In allerletzter Sekunde verschonte die Regie noch gnädig das Publikum vor einer blankziehenden Lena Odenthal, deren Mimik über neunzig Minuten facettenarm mit der Oberflächenbeachaffenheit ihrer abgetragenen Lederjacke korrespondierte. Nein, das wendet sich nicht gegen die rüstige Darstellerin der Hauptkommissarin aus Ludwigshafen, ganz im Gegenteil, aber gegen den infamen Versuch, eine spannungsarme Geschichte wiederzubeleben, die man interessanter in sechzig Minuten hätte erzählen können. Auf das bizarre Leichenklatschen, die waterboardingstylehafte Vorenthaltung des Asthmasprays, sowie die grotesk überzeichnete Tötungsinszenierung muss man gar nicht näher eingehen. Und ein Bono für Arme als Staatsanwalt vermochte als holzschnittartige, alte weisse CIS-Hete und Ausrufezeichen des pädagogischen Programms kaum zu überzeugen. Der dramaturgische Kniff, die Vorgeschichte von einer teilnahmslosen Verwandten des Opfers in wenigen Sekunden herunterleiern zu lassen, unterstrich nur noch den kosmetischen Charakter des kriminalgeschichtlichen Anteils der Sendung.
Alles in allem? Wie immer eigentlich. Es tut gleichmäßig weh. Diesmal war ich sogar zu erschöpft zum ausschalten. Das wird mir so schnell nicht wieder passieren. Mein Fehler.
Nachtrag: über die unausgewogen unterrepräsentierten Minderheiten gäbe es allerdings noch das eine oder andere Wörtchen zu verlieren, was hier den Rahmen sprengte. Immerhin hat man es geschafft, den Femizid per se als christentumureigene Ausfallerscheinung auszuweisen. Danke. Wieder was gelernt.