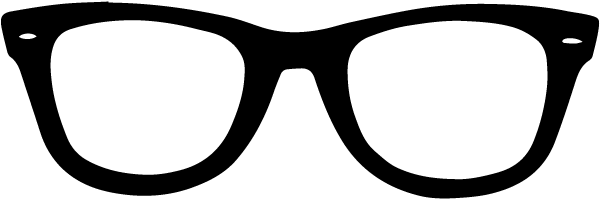„Wegen Liedern weinen wie die Mädchen.“
Heute morgen in nieseliger Früh, fand ich in meiner Timeline einen Post von Hawaii-Micky Beisenherz vom späten Vorabend, in dem er sich knapp dazu bekannte, nach einem Lied im Radio geweint zu haben wie ein Mädchen. Nicht wie ein Schloßhund. Oder heulte der? „Das kann Musik“, schrieb er verdichtend. Und dabei beließ er es auch schon ohne Details und erschließende Erläuterungen.
In nicht einmal acht darauffolgenden Stunden hatten bereits 160 Menschen ihre Sympathie zu dieser Aussage dokumentiert. Darunter Rauhbeine wie mein Facebookfreund Heinrich Schmitz, der neben seiner Juristerei betont nüchternsachliche Kolumnen veröffentlicht und mädchenhafter Schwärmereien bislang eher unverdächtig schien. Mit einem schlichten Like, einem Herzchen oder einem verlegenen Lachen. Solche Gemütslagen sind wirklich nicht leicht für echte Kerle.
Diesem Tränenteich mag ich auf den tieferen Grund schauen. Micky meinte in seiner memegewordenen Regung sicher nicht die hochemotionale Situation, nach hunderten zurückgelegten, nächtlichen Autobahnkilometern in monsunartigen Witterungsbedingungen auf dem Weg zur Liebsten, von Adele im Radio mit ihrem dramatischen Song „Set fire to the rain“ nadelstichartig der früher Altersamnesie gemahnt zu werden, versehentlich den heimischen Gasherd nicht abgeschaltet zu haben. Vielleicht. Doch das reicht schon.
Und es geht vermutlich nicht um die Musik selbst, deren kompositorische Anmut, die Eleganz des Arrangements und die Ästhetik der Produktion sich in Gänze nur den sachlich Versierten zu erschließen vermögen.
Er spricht also von der Verbindung. Dem, was Klang und Wort und manchmal auch ein Bild in uns auszulösen vermögen, weil sie einen Schukarton voller, oft unsortierter Erinnerungen aufreissen, den man vor Schreck so schnell nicht mehr zubekommt. Frauen können genießen darin zu schwelgen, zu wühlen, den Dingen nachzuspüren. Die meisten Männer hätten jedoch gerne baldmöglichst wieder einen Deckel drauf, bevor das noch einer mitbekommt. Denn es geht um offene Rechnungen. Mehr oder weniger. Meistens mit einem selbst. Man sitzt also sozusagen auf den eigenen Tränendrüsen. Und das so gewichtig wie bewegt.
Stefan Zweig hielt Sentimentalität für eine Ungeduld des Herzens. Ich halte sie für die Schwester der Melancholie und beide für ein bittersüßes Rauschmittel. Die Melancholie wirkt langsam. Sie ist ein süßes Gift. Ich selbst bin süchtig danach. Denn in melancholischen Momenten spüre ich die Schürfwunden auf meiner Seele. Ausgelöst werden die durch den passenden Impuls im richtigen Augenblick. Zum Beispiel dem besonderen Song, der selbst etwas beschreibt oder einen bedeutenden Zeitabschnitt zu greifen vermag.
Die Kindheit kennt das nicht. Da ist man froh oder traurig. Diese Gefühle vermischen zu können ist ein Privileg des Alterns. Vielleicht ähnlich der Erkenntnis, dass „bitter“ als Geschmacksrichtung eine ganz besondere Qualität haben kann, die aus meiner Sicht oftmals tragisch unterschätzt wird.
Der französische Dramatiker Nicolas de Chamfort, immerhin Mitglied der Académie Française, notierte in seiner Anekdotensammlung „Maximen und Gedanken“ von 1795: „Es gibt eine Melancholie, die mit der Größe des Geistes zusammenhängt.“ Ich spreche da lieber von der Weite des Geistes. Denn die fasst das Sortiment, die Klaviatur, die Möglichkeiten Dinge zu verknüpfen und daraus etwas entstehen zu lassen.
Im Gegensatz zu Micky habe ich keine Angst, mich erwischen zu lassen. Ich nenne Roß und Reiter und lasse das Messer nicht in der Sau stecken. Es gibt viele Lieder, Gedichte, Aphorismen, Filme oder Bilder, die etwas in mir auslösen jenseits von chronologisch verankerten Augenblicken. Es geht da mehr um das Unfassbare. Den „space between“.
Ein Song, der mich immer wieder stark berührt ist „stay or leave“ von Dave Matthews, der sich darin von seinem Freund, dem begnadeten Saxophonisten und Bandmitbegründer, Leroi Moore verabschiedet, nachdem dieser unerwartet an den Folgen eines Unfalls gestorben ist. Natürlich zu früh, nach vielen gemeinsamen Jahren und unzählbaren künstlerischen Erfolgen.
„Maybe different but remember
Winters warm where you and I
Kissing whiskey by the fire
With the snow outside
And when the summer comes
In the river
Swims at midnight
Shiver cold
Touch the bottom
Starry night
With muddy toes
refrain:
Stay or leave
I want you not to go
But you should
It was good as good goes
Stay or leave
I want you not to go
But you did
Wake up naked drinking coffee
Making plans to change the world
While the world is changing us
It was good good love
You used to laugh under the covers
Maybe not so often now
But the way I used to laugh with you
Was loud and hard
refrain
So what to do
With the rest of the day's afternoon hey
Isn't it …“
Das erinnert mich auch an meine Freunde, die leider nicht mehr da sind. Aber noch viel mehr an die gute Zeit, die wir miteinander haben durften. Noch zu neu, ist das kein Song, den wir gemeinsam gehört hatten und wohl leider auch nicht hören sollten. Kein Teil der gemeinsamen Biographie. Aber vielleicht macht auch gerade das den melancholischen Moment aus und jeder muss seinen ganz eigenen Impuls erfahren. Für sich alleine ist das nochmal ein ganz anderes Ding als die gemeinschaftliche Rückbesinnung mit Hilfe des gemeinsamen Erlebnisnenners: „Ain’t nobody love me better.“ Zum Beispiel.
Ich reise gerne mit einer Träne im Knopfloch.
© 2018 Bruno Schulz