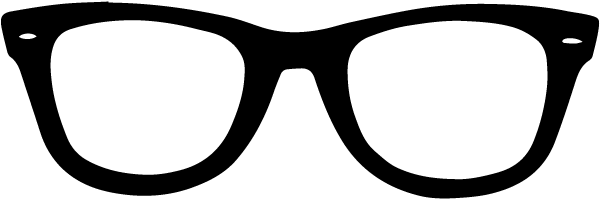Von Sandalen und Tennissocken.
Die Besitzer des Keramikcafé Mollehuset haben sich allergrößte Mühe gegeben, einen sehr gastlichen Ort zu schaffen, der eine besondere, kreative Atmosphäre und den detailverliebten Sinn für skandinavische „Tee- & Kaffeekulinarik“ auf handgefertigter Keramik auf das Trefflichste verbindet. Von der Magie des behutsam restaurierten architektonischen Kleinods selbst und seines Sommergärtchens ganz zu schweigen, den man uns Gästen zur versüßten Rast freundlich öffnet. Da mag ich nur allzu gerne etwas zurückgeben. Ein Zeichen des Respekts. Wenigstens das.
„Ich bezahle ja schließlich schon“, höre ich schon die ersten notorischen Nörgler raunen und kläffen, doch auch diese Binse greift wie in allen anderen Themen und Lebenslagen schon gewohnt zu kurz. Mit Geld honoriere ich allenfalls den banal rechenbaren Aufwand, aber nie den komplexen Zauber des Augenblicks.
Ich habe mich diesmal vorbereitet und trage bewusst, weil situativ angemessen, ein Leinenzelt im angenehm reduzierten Design des geschätzten schwedischen Schneiders Stenström - Überformat muss einen ja zum Glück nicht seines Anspruchs entbinden - und dazu einen Strohhut, passend zur zeitlosen Sommerfrische dieses kulturellen Außenpostens in der Provinz, dessen Mühen zur konsequenten Erhaltung uns die Gastgeber mit scheinbar lockerer Geste in keiner Sekunde spüren lassen und noch mit ausnehmender Zuvorkommenheit adeln.
Ich empfände meinen Aufenthalt als ganzheitlich sensorisches Erlebnis, dessen Reiz vielen Menschen heute abhanden gekommen zu sein scheint: ich sehe, höre, spüre, rieche, schmecke.
Da erstaunt mich, ohne mich tatsächlich zu überraschen, warum man dem Feinsinn und der Zartheit dieser kulturellen Fermate unbedingt dieses rustikale Statement entgegensetzen will, die Anwesenden mit einer Radlerhose zu konfrontierem und einem zum Blumenkohlgeschwür deformierten primären Geschlechtsorgan, das auf Augenhöhe stolz vorgetragen wird wie eine Monstranz zu einer Prozession des schlechten Geschmacks. Von den versprengten Camp-David-Litfasssäulen ganz zu schweigen oder den Paaren, die in ihrer Outdoorausstattungsgleiche offenbar andeuten wollen, jederzeit und zur Not auch in nordjütländischen Küstengefilden die Besteigung eines „Kangchendzönga“ - zur Not auch ohne Sauerstoffsupport! - bestehen zu können, mit immerhin 8.586 Metern der dritthöchste Berg der Welt und doch nur echten Insidern so geläufig wie dieser merkwürdige Fetisch zum unablässigen „Reinhold-Messner-Gedächtnis-Outfitkarneval“. Allesamt zeitgenössische Substitution der verlachten und einhellig verachteten Paarung aus Tennissocke und Sandale, des kleinsten gemeinsamen Nenners.
„Dieter, kannst mir mal eben den Dampfer aus dem Auto mitbringen?“ „Ich wollte doch gar nicht zum Auto, Inge?!“ „Jetzt schon“, meint die Inge und noch: „Kokos-Karibik, Dieter, Kokos“! Die Apokalypse: ein infernaler Mix aus akustischem wie olfaktorischem Tschernobyl. Ein sensorisch zweikanaliger Hochgenuss, der mit dem Ambiente harmoniert wie ein Mastschwein mit dem Welttag der Veganer.
Mir wird von den allgegenwärtigen, dauerempörten Advokaten des lärmigen Unterdurchschnitts in den sozialen Medien regelmäßig aufgetischt, mein nur vermeintlich holistisches Gespür für die Schönheit des Augenblicks sei nichts als Maniriertheit und alberne Affektiertheit, reine Realitätsverweigerung. Kein Problem, es ist ja auch immer eine Frage der Perspektive und meine Idee von Pluralismus steht das locker durch. Der Denkfehler im wurstig wütenden Schnappreflex liegt übrigens wohl darin, ich verhalte mich ausnahmslos für andere. Als könne ich den eingangs bezeichneten Respekt nicht einfach nur mir selbst zollen als Zeichen von Selbstwirksamkeit und von tiefer Gelassenheit im Umgang mit mir und der Welt.