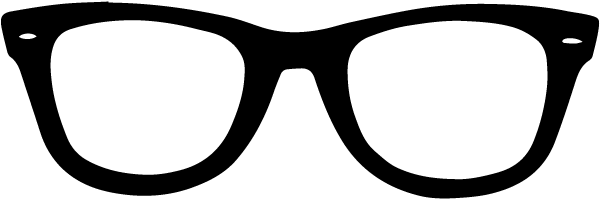Knickebein.
Als Kind behauptete ich steif und fest, nach dem ersten so unglücklichen wie zufälligen, jähen gustatorischen Totalschaden auf grüner Aprilwiese mit schreckverzerrtem Gesicht und angstgeweiteten Augen, die nun wohl kein Grauen von Menschenhand mehr überraschen würde können, bei der Füllung „Knickebein“ handle es sich vermutlich um das giftige Drüsensekret einer seltenen Leguanart von einer Inselgruppe in der Adamanensee, die ich kurz zuvor bei einer Weltreise mit dem Zeigefinger auf dem beleuchteten Globus meiner Großmutter entdeckt hatte. Gott hab sie selig.
Ich haderte ab sofort sehr mit der Süßwarenindustrie aus der zweiten Reihe, die mit dieser unglücklichen Liaison aus Schokolade und exotischer Tierkörperverwertung wohl einem unterstellten, schäbigen Erziehungsauftrag nachkommen sollte. Bestenfalls konnte es darum gehen, Kinder künftig zu kurzem Einhalt vor dem Verzehr von Schokoladeneiern zu konditionieren, um sie damit rustikal zu der ernüchternden Erkenntnis zu führen, dass ab sofort wirklich alles irgendwie auch eine Schattenseite haben dürfte.
Die Vokabel „konditionieren“ hat übrigens nachweislich und erstrecht in diesem Fall etymologisch rein gar nichts mit dem zauberschönen Begriff Konditorei gemein. Anmerkung Ende.
Der billige Fuselalkohol in der toxischen Lackbeize spielte bei diesem Blut-Hirn-Schranken-gängigen Experiment vermutlich eine eher untergeordnete Rolle in Richtung „Mekongwhisky“ wirkend, den man in Südostasien als Reisender vor allem immer dann schluckt, wenn man sich den Magen radikal verdorben zu haben glaubt, also prophylaktisch. Das Qualitätslevel unterläuft dabei mühelos noch alle mariobarthwitzflachen Standards auf indischen Hochzeitsgesellschaften, bei denen regelmäßig zum Toast auf das Brautpaar mehrere hundert Gäste Teile ihrer Sehkraft aufzugeben gewillt sind.
Die Ostergesellschaft aus meinen Verwandten im Feiertagsstaat war seinerzeit jedenfalls sehr erschrocken und ich erinnere mich noch ziemlich genau, wie sie mich als aufgereihter Chor in einer Art Kanon rhythmisch dazu anhielten, den teuflischen Schleim wieder loszuwerden: „Spuck es aus ... spuck es aus!“ Das Schauspiel musste an Linda Blair gemahnen, wie sie damals den Satan ausspieh in „Der Exorzist“.
Die Nummer habe ich mir dann als lebenrettenden Reflex für alle künftigen Situationen bewahrt, in denen die kulinarische Empfehlung „das musst Du versuchen“ außer Kontrolle zu geraten drohte.
Vielleicht hatte es also doch auch etwas positives und mit der Anekdote meinen Ruf untermauert, in allem Schrecken auch etwas Lehrhaftes und somit Gutes erkennen zu wollen. Das Muster „Hoffnung“.
Wie auch immer, frohe Ostern.