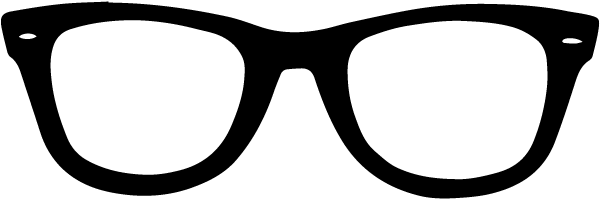Sprachnazis fressen Adjektive.
Gestern bin ich schon wieder in die Scharfrichterei von selbsterkorenen Sprachschleifer*Innen geraten, die vermutlich nicht nur zum lachen in den Keller gehen, sondern ebenso zum lesen. Im Dunklen. Unter einer protestantischen Wohnkate in den kargen Weiten der winterlichen schwäbischen Alb, in der als eindrücklichstes Fanal von Lebensfreude bestenfalls der abgestandene Achselgeruch der tagein, tagaus essigsauer dreingrienenden Zugehfrau steht, die nicht ganz unverschuldet im monotonen Schwarz ihres bewusst dokumentierten, langjährigen Witwendaseins mit ihrem als nach unten geöffnetem Halbkreis eingefrorenen Mund die Welt stets mürrisch daran erinnert, dass sie neben ihrem Verschiedenen immer auch in der Lage sein wird, jeden anderen zu jeder Zeit mit ihrer verinnerlichten Humorlosigkeit einzutrocknen.
Diese Leute haben Schreibregeln aufgestellt. Anachronistische Lehrstammtischparolen zur ruppigen Domestizierung von Prosa. Ihre lustigste Anekdote ist noch der Satz, den Georges Clemençeau, der spätere französische Ministerpräsident, zu einem neuen Kollegen sagte, als er noch Schriftleiter der Zeitung La Justice war: „Schreiben Sie kurze Sätze: Hauptwort, Verbum, Objekt: fertig! Bevor Sie ein Adjektiv schreiben, kommen Sie zu mir in den dritten Stock und fragen, ob es nötig ist.“ Oha, alles lacht hier auf Kommando. Frauen, die solche Geschichtchen lustig finden, stehen auch auf Kerle in Uniformen und die härtere Gangart. Und die Kerle auf das Pendant in Latex.
Ist Sprache Bestrafung? Ich hoffe nicht. Für mich ist das Schreiben lieber Blumenwiese als Festungshaft, lieber Freiheit als Volksgerichtshof, aber das muss wohl jeder für sich selbst einordnen.
Und als ob möglichst viele betagte Referenzen ihre wacklige Rhetorik untermauerten,legen sie gleich nach: „Schreibe mit Hauptwörtern und Verben, nicht mit Adjektiven und Adverbien. Das Adjektiv ist noch nicht geschaffen, das ein schlappes oder ungenaues Hauptwort aus der Klemme zieht. Das hat so der gefühlt tausend Jahre alte Journalist und „Sprachstilkundler“ Wolf Schneider schon seit dem Spätmittelalter ventiliert und in seinem epochalen Werk mit dem bescheidenen Titel „Deutsch für Kenner“ niedergeschrieben. Für manche Schreibblogger*Innen unerschöpflicher Quell und Mantra, für mich die zehn Gebote von Ohnmacht und Sprachlosigkeit, wenn man sich nur exklusiv darauf verlassen will. Windschattengeschreibe. Nur mäßig originär und selten originell.
Naja, es kommt wohl auch ein bisschen auf die Qualität der Adjektive an. Und wenn man schon die Hauptwörter nicht findet, könnte man das Schreiben eigentlich (Füllwort!) gleich drangeben. Genaues hinsehen, eine modellierende Beschreibung und dazu ein Quäntchen Phantasie sind in der Lage, vieles zu richten.
„Die Analogie ist das Herz des Denkens“ ist ein Satz, den der Physiker, Informatiker und Kognitionswissenschaftler Douglas R. Hofstadter so schön fand, dass er ihn als Autor zu einem seiner Buchtitel machte. Unter anderem werden darin Versuche beschrieben, in absolut abgedunkelten Räumen komplexe Sachverhalte so zu beschreiben, auf dass sie verstanden werden. Das gelingt, indem aus Worten Bilder werden dürfen. Der berühmte „Film im Kopf“.
Für den Roman hat Gustave Flauberts "Madame Bovary" eine besondere Bedeutung. James Wood ist Professor für Literaturkritik an der Harvard University. Er hat das großartige, unbedingt empfehlenswerte Buch „Die Kunst des Erzählens“ geschrieben und hält darin fest: "Die Romanautoren sollten Flaubert danken wie die Lyriker dem Frühling. Mit ihm beginnt alles. Es gibt tatsächlich ein Zeitalter vor Flaubert und ein Zeitalter nach ihm. Flaubert hat genau das begründet, was die meisten Leser und Autoren für modernes realistisches Erzählen halten…". Flauberts Beschreibung eines Marktbesuches mit all seinen sinnlichen Eindrücken ist so gegenständlich wie eine gekonnte Kamerafahrt. Man meint, die reichen Farben zu sehen, die explodierende Blumenpracht zu riechen, die vielen geschwätzigen Leute zu hören, das abgenutzte Pflaster unter den Füßen zu spüren. Ohne die adäquaten Adjektive ist das alles unvorstellbar.
Die Welt ist ein Dschungel und kein karger Felsen im Nordatlantik, der von nichts als Eis und Vogelsche*ße zusammengehalten wird.
À propos: die Inuit haben angeblich 100 Hauptwörter für Schnee. Dieses prominente Missverständnis geht auf den Ethnologen und Sprachwissenschaftler Franz Boas zurück, der sein romantisches Märchen erstmals 1911 publizierte. Tatsächlich haben die Inuit so viele und so wenige Wörter für Schnee wie wir. Sie bilden daraus allerdings Komposita, zusammen mit Adjektiven, um den Sachverhalt zu verdeutlichen. Und darum geht es immer. Bestenfalls.
In der Sapir-Whorf-Hypothese, einer Annahme aus der Linguistik, formt Sprache das Denken. Darin geht es um die Vorbestimmung der Erfahrungswelten von Sprachgemeinschaften durch die lexikalischen, aber auch grammatikalischen Strukturen ihres Austauschs von Information.
Mir wird immer wieder vorgeworfen, meine Notizen in den sozialen Kanälen und besonders auf Facebook seien zu „anstrengend“ und das „könne doch kein Mensch lesen“. Gerne mit inflationär eingewürfelten Satzzeichen. Darauf entgegne ich gerne, dass mir das Schreiben vor allem selbst Freude bereiten muss, denn es ist mein Golfspiel, mein Fußball, mein Fliegenfischen, mein Sportschießen, Briefmarken- und Schallplattensammeln und so weiter und so fort. Wenn es dann noch jemand lesen möchte, freut mich das umso mehr. Aber ich mache es eben nicht dafür.
Guten Morgen.