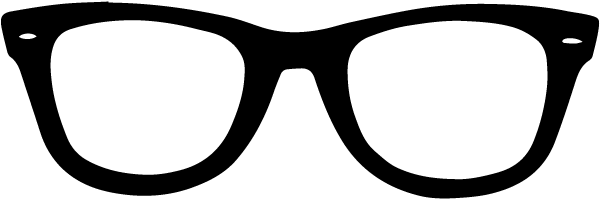Vom Paradoxon anzukommen, um Abstand zu finden.
Es ist erst der vierte Tag dieser Reise, kaum der zweite Tag am Ziel in der nordjütländischen Jammerbucht und der Erste in zutiefst empfundener Freiheit, meiner Sommerfrische im allerbesten, tradierten Sinn, an dem ich abends einen deutlich beruhigten Rhythmus finde und eine gelassenere Sicht auf die Welt und mich in ihr. Auf der Terrasse. Die tiefe Sonne kriecht langsam über meine Haut und streichelt sich zuckersüß in mein Gemüt. Im alten, löchrigen Polohemd, verwaschen, verfärbt, verbeult, zerschleudert, sitze ich hier, so wie mein Vater sie auch schon gerne getragen hatte am gleichen Sehnsuchtsort vor vielen Jahren für viele ebendieser, der uns verband und über seinen Tod hinaus für alle Zeit verbindet.
Die „Entschleunigung“ ist ein totbenutztes und darin entwürdigtes Wort und doch ist es eben die gezielte Verlangsamung, die ich mit diesem Platz in sicherer Selbstverständlichkeit in Verbindung bringen darf. Obwohl noch keine achtundvierzig Stunden da, waren es schon jetzt mehrere ausgedehnte Strandspaziergänge, zu denen ich mit jedem Schritt wohl mehr erspüren soll, wie ich mir meine Entfernung erlaufe. Nicht als Flucht, vielmehr zur nüchteren Betrachtung in Distanz. Eine Annäherung um des Abstandes Willen, ein Paradoxon wie aus dem Bilderbuch der nicht selten tragischen Selbstoptimierer.
Die Wege fielen auf immergleicher Strecke sehr unterschiedlich aus. Mal begleitet von starkem Wind über aufgewühlter See, dramatische Wolkenungetüme schienen sich zu verschwören, jagten einander, wurden Formationen, rissen plötzlich auf, um gleich wieder zusammenzuwachsen und wütende Böen peitschten scharf auf den einsamen, verlassenen Strand. Oder sommerlich, zwischen weitläufig verteilten Gruppen von Menschen in homöopathischen Dosen, Paare und Familien, nur wenige Einzelgänger, die sich unweit des Meeressaumes verteilten wie die Noten auf einer spärlich sperrigen Partitur einer dieser skandinavischen Abstraktionen, die in großzügiger Leere zu bestehen verstehen und dabei doch eine vielleicht ungewollte aber gemeinsam Harmonie erkennen lassen. Wer einmal das Werk „Khmer“ des norwegischen Jazztrompeters Nils Petter Molvaer gehört hat ahnt vermutlich umgehend, was ich meinen könnte.
So oder so, die Ouvertüre ist immer gleich: der Weg vom einfachen Holzhaus, das sich mit seinem Grasdach mutig gegen alle Stürme in die sanften Hügel duckt, durch dessen eigenen Strandstieg, ein Hohlweg aus duftenden Heckenröschen, der sich leise schlängelnd durch die Dünenlandschaft tanzt und über ein letztes Auf in einer grenzenlos anmutenden Fläche mündet, dieser Weite, die sich selbst aus Licht, Wind, Sand und Wasser stets aufs Neue zusammensetzt und auf mich wirkt wie das Urushi, ein Kitt, der kunstvoll die Scherben verbindet im Kintsugi, der japanischen Kunst, entzweite Keramik mit Gold erneut zu fügen, stabiler als je zuvor. Man versucht die Brüche nicht zu verbergen, aber versteht sie zu veredeln. So könnte sich das anfühlen, vielleicht, weil hier nicht immer alles wirklich sein muss.
Und die Erkenntnis ist heute, um mit Paulchen Panther zu sprechen, dass das nicht alle Tage ist. Ich komm‘ wieder, keine Frage, aber vielleicht doch diese eine: wie oft noch?