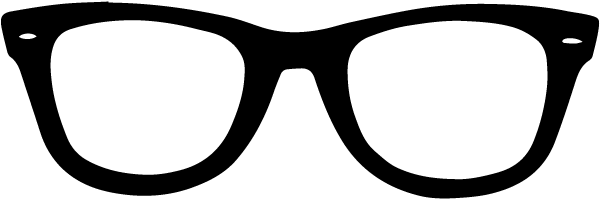Ist weniger mehr?
Zwischen dem, was man braucht und dem, was man hat liegt ein Universum.
Der englische Romantiker William Wordsworth empfahl bereits im frühen neunzehnten Jahrhundert in seinen „Lyrical Ballads“, wenn er nicht gerade wieder einsam wie eine Wolke wanderte, um sich an Narzissen zu erfreuen, die in seiner Sprache großartigerweise „daffodils“ heissen, „in Einfachheit zu leben und in Größe zu denken“. Das ist selbstverständlich daherphilosophiert in unfreiwillig bescheidenen Verhältnissen und noch leichter dahergesagt nach einer unerwarteten Erbschaft.
Seitdem ich das mit den Narzissen weiß, sehe ich den automobildarstellenden Zweig des niederländischen DAF-Konzerns rückwirkend in einem ganz anderem Licht erstrahlen, dessen variomatikgetriebene Gehhilfen in all ihrer Bescheidenheit in Ästhetik wie Fahrleistung die englische Übersetzung der besagten Blume als zärtliche Bespitznamung fanden. Fahrende Handgelenktaschen, Autos, die konstruktionsbedingt nur ein einziges Vorwärts oder eben ihr Rückwärts kannten. Gleichschnell übrigens wie H.G. Wells Zeitmaschine im Vor und Zurück. Der Großvater eines Jugendfreundes besaß ein solches Gefährt, einen DAF 66 Marathon - keine Zeitmaschine, passend zu seiner beigen Windjacke und den gleichfarbigen Gesundheitsschuhen unter dem messerscharfgebügelten Beinkleid, die man ja eigentlich immer erst dann trägt, wenn schon nichts mehr zu retten ist. Nach einer glaubhaft überlieferten Erinnerung, beantwortete er während einer Sonntagsausfahrt durch den schönen Soonwald die neugierige Frage seines Enkels, was denn das „R“ auf dem schlicht zweistufigen Schalthebel bedeute, so tollkühn wie offenbar überzeugend, das stünde für „Rallye“ ohne zu ahnen, dass ihm der junge Mann das wohl tatsächlich zutraute und mit einem beherzten Gangwechsel als Copilotenlegende in die Rennsportgeschichte einzugehen gedachte, um Opas orangelackierten Stolz nach einem gewaltigen Ruck augenblicklich vollständig zu entwerten und den einstmals stolzen Eigner künftig auf einen kleinsten Aktionsradius zurückzuwerfen.
Die Zirkusnummer mit dem DAF ist an dieser Stelle sicher Ergebnis geistigen Vagabundierens, was mir erstaunlich regelmäßig attestiert wird, wie auch immer das gemeint sein soll. Und doch passt das Minimum an motorisierter Autonomie ganz wunderbar ins Sujet: was brauche ich, um voranzukommen und was habe ich tatsächlich? Die Spanne zwischen zwei gesunden Beinen und der chauffeurgesteuerten Pretiose ist doch beträchtlich und reicht noch bei weitem nicht aus, wie wir erst kürzlich in den Medien erfahren durften aus einem merkwürdigen Gliedvorzeigerwettbewerb dreier Milliardäre, die ihren unappetitlichen Reichtum, ihre Menschenverachtung und die konsequente Ignoranz jeden gedeihlichen Miteinanders durch ihre individuelle Weltraummobilität exponieren mochten. Heute reicht es nicht mehr, bei Cowboy- und Indianerspielen, pardon: der nachgestellten Unterdrückung Indigener durch zivile Kolonialtruppen, mit der längsten Flinte zu glänzen, es muss gleich ein modifizierter Milleniumfalke des Corellianers Han Solo in Form eines primären Geschlechtsorgans sein. Der Gewinner heisst vorerst Jeff Bezos, der das alles als Früchte seiner harten Arbeit und der großen Verantwortung verstanden wissen will und als Fenster zur Zukunft, das er nun für alle aufstoße, wer immer das auch sein soll. Die Leute, die seinen Reichtum zusammengetragen haben meint er sicher nicht.
Und doch ist das Weltraumspektakel nur eine Fortsetzung mit anderen Mitteln und noch lange nicht das Ende. Zuletzt ging es noch um das höchste Haus der Welt und ein paar Rekordnebenkriegschauplätze, das ein paar eitle orientalische Philanthropen als stählerne Phallusplastik in den Wüstensand ihres schrillen Bling-Bling-Rummelplatzes Dubai gesetzt haben und auf bald einem Kilometer der Stratosphäre entgegenwachsen ließen: ursprünglich „Burj Dubai“, später „Burj Khalifa“, benannt nach Chalifa bin Zayid Al Nahyan, dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, sowie Emir, Premierminister von Abu Dhabi und ausgewiesener Empathiepreisträger, der den sich verzockenden Verwandten wohl wieder mal den Arsch gerettet hat. Auch hier darf man sich bei aller Faszination für bizarre Auswüchse und die schlichtmichelige Begeisterung für die Verschiebung der Grenzen alles Machbaren die Frage stellen, was der Mensch tatsächlich zum Wohnen braucht.
Das Spektrum ist breit zwischen den persönlichen Unterkünften eines Vertreters des sehr ursprünglichen Himbastammes in Namibia oder eines indischen Petrochemiemilliardärs Mukesh Ambani, der seine ausgefallenen Bedürfnisse im Haus „Antilia“ zu Mumbai manifestierte. Benannt nach einer mythischen Phantominsel im Atlantik, beherbergt das bescheidene private Wohneigentum siebenundzwanzig Stockwerke auf immerhin einhundertdreiundsiebzig Metern Höhe, auf denen konventionell bis zu fünfzig Wohnebenen Platz fänden in einer dystopischen Metropole, in der menschenwürdiges Wohnen für einen Großteil der Bevölkerung für immer unerreichbar bleiben wird.
Möchte ich mit meinen Vergleichen, zu denen sich mühelos unzählige Disziplinen hinzufügen ließen, das stumpfsinnige Neidargument provozieren, die sprachliche Jogginghose der rhetorisch Unbewaffneten? Natürlich nicht, sonst hätte ich nicht die vielen Graustufen offengelassen. Es geht um eine subjektive Feinjustierung der eigenen Ansprüche zwischen dem Nichts und der Konsumapokalypse.
Bin ich selbst ein Kandidat für die Challenge „100 things“, die sich der amerikanische Unternehmer David Michael Bruno ausgedacht hat, um daraus wiederum einen dieser neumodischen Selbstoptimierungsbusinesscases zu formulieren und dabei die Spielregeln für sich selbst umgehend auszuhebeln, indem er beispielsweise seine Bücher nicht einzeln, sondern unter dem Begriff Bibliothek zu einem einzigen Zähler fusioniert? Oder Socken, die unabhängig ihrer Zahl immer nur einmal als Socken geführt werden. Ziemlich albern. Ein besonders Gleicher unter Gleichen. Da kann man ja gleich die historische Sportwagensammlung und die privaten Düsenflieger als Einheit „Mobilität“ deklarieren. Für solchen Unfug bin ich nicht zu haben. Sekt oder Selters, barfuß oder Lackschuh, wenn schon, dann richtig, aber mich lasst da mal raus. Ich halte nichts von plakativen Formeln, mit denen alle über einen Kamm geschoren werden sollen. Solche Ideen schmecken nach Pol Pot und das war nichts zum Rauchen.
Ein bisschen Besonnenheit und Kontemplation kann dennoch kaum schaden. Dazu muss ich mich ja nicht gleich ins japanische Kloster Antai-ji begeben, um nach entbehrungsreicher Beschulung in Demut und Bescheidenheit als asketischer Zenmeister zu reüssieren.
Mir reicht dazu ein ausgedehnter Strandspaziergang, barfuß in Badehose und altem Jeanshemd, um für mich selbst herauszufinden: wenn man wirklich Zufriedenheit sucht, befindet man sich mit der Einfachheit in allerbester Gesellschaft.
Es geht nicht um das Nichts, aber um das Bewusstsein, dass Geld vielleicht einiges erleichtern mag, aber alleine kaum glücklich macht. Besitz bietet vor allem vermeintliche Sicherheit, die man mit Verantwortung, Druck, aber vor allem Angst bezahlt, zu scheitern und vor Verlust. Und mit Neid und Missgunst in einem merkwürdig oberflächlichen Wettbewerb, der nie zu gewinnen sein wird.
Darum öffne ich jetzt einen kühlfachkalten, neuseeländischen Sauvignon Blanc, proste der Abendsonne zu und der dänischen Nordsee, auf die ich von meiner wettergegerbten, shabbyschicken Veranda über das sich sanft im Wind bewegende Dünengras blicke. Ganz gerührt von meiner eigenen Bescheidenheit, oder dem was ich gerade in diesem Augenblick dafür halte. Es bleibt eben eine Sache der privaten Perspektive, was man tun kann und was man lassen sollte um für sich selbst die Frage beantworten zu können, ob weniger nicht manchmal mehr wäre. Und ob die Quelle nun Christoph Martin Wieland, Robert Browning oder Ludwig Mies van der Rohe heisst, ist mir vollkommen schnuppe. Schon wieder fange ich an, mich zu entlasten.